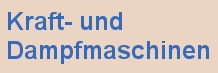|
|
Rheinische Gummi- und Celluloid-Fabrik
| Firmenname | Rheinische Gummi- und Celluloid-Fabrik |
| Ortssitz | Mannheim |
| Ortsteil | Neckarau |
| Straße | Eisenbahnstr. 4 - 8 |
| Postleitzahl | 68199 |
| Art des Unternehmens | Gummi- und Celluloidfabrik |
| Anmerkungen | Bis 1885: "Rheinische (Hart)gummi-Waaren-Fabrik" (s.d.). Siehe auch: Werk Rheinau! 1892: Direktoren: Friedr. Bensinger u. Ad. Bensinger; Adresse: M 2, 16; Produkte: Technische u. Hartgummiwaren. Ab 1965: "Schildkröt AG, vormals Rheinische Gummi- und Celloloid-Fabrik" (s.d.). |
| Quellenangaben | [Braas: Kunststoff, gestern-heute-morgen (1973)] [Zum 25j. Jubiläum der Rh G & C F (1898) mit Abb.] [Adressbuch Elektr.-Branche (1892) 168] [Fillafer: Die Schildkröt (1995)] |
| Hinweise | Kessel- und Maschinenhaus seit ca. 1998 an Prof. Dr. Dr. M√ľhling (s.d.), Heidelberg und von ihm renoviert. [100 Jahre chemische Industrie im Rhein-Neckar-Dreieck (1999) 72]: Werksansicht um 1900 |
| Zeit |
Ereignis |
| 1885 |
Weitere Ereignisse vor 1885 s. "Rheinische Hartgummi-Waaren-Fabrik" (ID= 1765) |
| 1885 |
Wiederaufbau der Werksanlagen nach dem Brande vom 27. M√§rz: Er nimmt nahezu ein ganzes Jahr in Anspruch. Die ganze Fabrik wird neu und zweckm√§√üiger wieder aufgebaut. Dazu wird ein G√ľterkomplex angekauft, und die einzelnen Betriebe werden derart auseinandergezogen, so da√ü jeder Bau, meistens einst√∂ckig, von den Nachbarbauten durch H√∂fe und Gehwege, zum mindesten durch erhebliche Brandgiebel abgetrennt werden. Die einst√∂ckigen Geb√§ude bestehen aus massiven Umfassungsmauern mit leichtem Dachwerk. - Diese Bauweise bew√§hrt sich und wird bei k√ľnftigen Bauten weiterhin angewendet. |
| Sept. 1885 |
Firmenänderung aus "Rheinische Hartgummi-Waaren-Fabrik" |
| 1886 |
Beginn der Herstellung von Schirm- und Stockgriffen |
| nach 1885 |
Man erkennt die unterschiedlichen Nitrierstufen und kann massenhaft reines Celluloid herstellen. |
| Fr√ľhj. 1886 |
Nach √§u√üerst schwierigen Verhandlungen mit den Feuerversicherungsgesellschaften wird wegen des Brandes vom M√§rz 1885 ein Vergleich abgeschlossen, infolge dessen das Unternehmen einen starken Verlust erleidet. Die Rentabilit√§t wird dadurch √ľber Jahre hinweg stark herabgemindert. |
| ab 1886 |
Die Fabrik wird seitdem ununterbrochen erweitert und ergänzt. |
| 1886 |
Bau einer nicht unbedeutenden Konstruktions- und Reparaturwerkst√§tte mit Eisen- und Kupferschmiede, Schlosserei, Klempnerei, Schreinerei, Gie√üerei usw. Seitdem baut die Fabrik den gr√∂√üten Teil ihrer Spezialmaschinen selbst oder l√§√üt gr√∂√üere Maschinen nach eigenen Entw√ľrfen ausw√§rts arbeiten. |
| 1887 |
Durch französische Geschäftspartner angeregt, werden ab 1887 Spielbälle aus Celluloid gefertigt. |
| Fr√ľhj. 1888 |
Mit der Errichtung einer vollst√§ndig selbst√§ndigen Fabrik mit eigenem Kesselhaus und Dampfmaschinenenanlage wird die Fabrikation des Celluloids auch r√§umlich von der alten Anlage f√ľr Hartgummi und Celluloidwaren gel√∂st. |
| 1888 |
Plötzlicher Tod des Ingenieurs und Maschinenmeisters Julius Ries |
| Okt. 1888 |
Adolf Bensinger, der √§lteste Sohn des Begr√ľnders, tritt in die Direktion ein. - Er war bereits eine Reihe von Jahren im Unternehmen t√§tig. |
| 09.10.1889 |
Anmeldung des Markenzeichens "Schildkr√∂t" f√ľr Celluloidwaren. (Eintragung 1899) |
| Sommer 1891 |
Tod des Firmengr√ľnders Friedrich Julius Bensinger im Alter von 50 Jahren |
| 04.1893 |
Carl Bensinger, der zweite Sohn des Begr√ľnders, tritt in den Vorstand der Gesellschaft ein |
| 15.10.1893 |
Großherzog Friedrich von Baden besucht das Werk. Er spricht seine allerhöchste Anerkennung aus. |
| 1894 |
Das Warenzeichen "Schildkröt" wird beim Kaiserlichen Patentamt in die Warenzeichenrolle eingetragen. (vergl. 1899) |
| 1895 |
Robert Zeller, der "Vater" der Celluloid-Puppe, schafft es, mit Hilfe eines neuen Blasverfahrens ("Preßblasverfahren"), Puppenköpfe und -körper billig herzustellen. |
| 1896 |
Die erste Puppe der Marke "Schildkr√∂t" geht √ľber den Ladentisch |
| 1898 |
Größe des Werksgeländes: 80.000 m2 |
| 1898 |
An Sozialeinrichtungen existiert 1898: 1 Betriebskrankenkasse, 2 Kantinen, 1 Kohlenkasse |
| 08.03.1899 |
Eintrag des Warenzeichens "Schildkröte" beim Kaiserlichen Patentamt. Der Siegeszug der Mannheimer Puppen mit der "Schildkröte" als Schutzmarke beginnt. |
| 1900-1960 |
Mannheim ist von ca. 1900 bis 1960 marktbestimmender Puppen-Produktionsstandort in Europa. |
| 1900 |
Die Firma ist bis 1900 ein Großunternehmen mit etwa 150 Gebäuden, in denen 65 Walzwerke und Kalander, 105 Pressen sowie 170 Kammschneidemaschinen betrieben werden. |
| 1900 |
Bis zur Jahrhundertwende steigert das Mannheimer Unternehmen seine jährliche Rohcelluloidproduktion auf etwa 4.500 t. Das entspricht einem Drittel der Weltproduktion. |
| 1903 |
Erfindung des Preß-Kammes aus Celloloid. Er ist ein Meilenstein technischer Rationalisierung. Bei jedem Preßvorgang entstehen im Zwei-Minuten-Takt 12 Kämme, die ohne wesentliche Nacharbeit "in einem Guß" hergestellt werden. Es sind 20 Pressen eingesetzt. Der Preßkamm wird zum ersten Massenprodukt. |
| 1910 |
Im Schwetzinger Werk der Rheinischen Gummi- und Celluloidfabrik wird die Puppenproduktion eingestellt und stattdessen bis zum Ersten Weltkrieg "Perlseide" gefertigt. |
| 1910 |
Im Schwetzinger Werk wird die Puppenproduktion eingestellt und stattdessen bis zum Ersten Weltkrieg "Perlseide" gefertigt. |
| 01.01.1915 bis 11.11.1918 |
Zwangsweise Stillegung der Gummifabrik bis Kriegsende |
| 1929 |
Verkauf der Aktien an die I.G.-Farben-Gruppe |
| 1929 |
Die Rheinische wird ein billiges Objekt der gefräßigen IG Farben-Gruppe. |
| 1929 |
Den Höhepunkt der Celluloidherstellung bildet das Jahr 1929 mit etwa 40.000 t Jahresproduktion. |
| 1929 |
Der Leiter der Abteilung Statistik bezichtigt in einer Vorstandssitzung den Betriebsleiter des Rheinauer Werks, jahrelang die Abrechnungen √ľber Produktionsmengen und Betriebskosten gef√§lscht zu haben. Die versammelten Herren beschlie√üen, ohne Voranmeldung ins Werk Rheinau zu fahren, um den Vorwurf zu √ľberpr√ľfen. Carl Bensinger, Paul Jander und die anderen Vorstandsmitglieder erscheinen im Rheinauer Betriebsb√ľro, und einer Betriebspr√ľfung wird den Verantwortlichen klar, welch ungeheurem Schwindel sie jahrelang aufgesessen sind. Mehr als 4 Millionen Mark sind verloren, und das Eigenkapital ist aufgezehrt. |
| Fr√ľhjahr 1930 |
Der Nitrierbetrieb im Werk Rheinau wird nach 49 Jahren stillgelegt, obwohl er (im Gegensatz zur im Vorjahr eingestellten Kampfer-Produktion) wirtschaftlich arbeitet. Ein Teil der Besch√§ftigten wird vom Stammwerk √ľbernommen. Die f√ľr die Herstellung von Celluloid erforderliche Nitrocellulose liefert nun das WASAG-Werk in Reinsdorf. |
| 1931-1932 |
Massenentlassungen |
| 1932-1936 |
Beginn der Entwicklung und Anwendung von Kunststofferzeugnissen auf der Basis von Misch-Polymerisaten in Zusammenarbeit mit I.G.-Farben |
| 1933-1939 |
Starker Ausbau der Fertigwaren-Betriebe |
| 1933 |
Der Umsatz beträgt 6 Mio RM |
| 1939 |
Bahnbrechende technologische Erfolge bei der Igelit-Verarbeitung, PVC |
| 1939 |
Der Umsatz beträgt 16,5 Mio RM. |
| 1939 |
Die Fertigung von Celluloidspielwaren ist ein Verlustgeschäft. so verliert die "Rheinische" mit jedem Kilo Spielwaren 3,52 RM. |
| 30.12.1943 |
Bei einem Luftangriff verlieren 21 Mitarbeiter ihr Leben, √ľber 50 werden verletzt |
| 1945 |
Die Schildkröt-Puppen landen bei der Wasag AG. |
| 01.04.1945 |
Das Werk gerät unter Artilleriebeschuß, die Belegschaft wird beurlaubt |
| 01.05.1945 |
Tr√ľmmerbeseitigung, 450 Mitarbeiter finden sich wieder ein |
| 1951 |
Das Produktionsvolumen entspricht dem Vorkriegsstand |
| 1953 |
Die Wasag-Chemie, Essen wird alleinige Aktionärin |
| 1954 |
Käthe Kruse entschließt sich, mit der "Rheinischen Gummi- und Celluloidfabrik" zusammenzuarbeiten. Man entwickelt eine erschwingliche Puppe aus Celluloid bzw. aus Tortulon, der in Gegensatz zu Celluloid nicht brennbar ist. |
| 1955 |
Herstellung von Hart-PVC-Platten "Rhenadur" f√ľr technische Gebrauchsartikel |
| Mitte 1950er |
Verkauf des bisher verpachteten Rheinauer Betriebsgeländes. Mit dem Erlös wird der Aufbau neuer Kunststoffabriken in Neckarau und Hemsbach finanziert. |
| 1956 |
√úbernahme der Produktion von Weich-PVC-Folien |
| 1958 |
√úbernahme des "Oppanol"-Folienprogramms |
| 1958 |
√úbernahme der Chemisch-Technischen Fabrik Hemsbach, die bereits seit 1953 Polyisobutylen zu Dachbahnen verarbeitet |
| 1965 |
Gr√ľndung der nordamerikanischen Vertriebsgesellschaft |
| 1965 |
Umwandlung des Firmennamens in "Schildkröt AG, vormals Rheinische Gummi- und Celloloid-Fabrik" |
| 1975 |
Die Puppenproduktion wird in Mannheim eingestellt. |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Celloloid |
1885 |
Brand und Umfirmierung |
1965 |
Letzte Erwähnung |
1885: Brand und Umfirmierung; 1965: Umfirmierung |
| Celluloid |
1949 |
Erste Erwähnung |
1949 |
Letzte Erwähnung |
1949: bekannt |
| Gummi |
1949 |
Erste Erwähnung |
1949 |
Letzte Erwähnung |
1949: bekannt |
| Gummiwaren |
1885 |
Brand und Umfirmierung |
1892 |
[Adressb Elektr.-Branche (1892)] |
1885: Brand und Umfirmierung |
| Hart-PVC-Platten "Rhenadur" |
1955 |
Erste Erwähnung |
1955 |
Letzte Erwähnung |
1955: Beginn der Herstellung |
| Igelit, PVC |
1939 |
Erste Erwähnung |
1939 |
Letzte Erwähnung |
1939: Bahnbrechende Erfolge |
| Preß-Kämme aus Celloloid |
1903 |
Erste Erwähnung |
1896 |
Letzte Erwähnung |
1903:Beginn; 1896: 171 Maschinen tätig |
| Weich-PVC-Folien |
1956 |
Erste Erwähnung |
1965 |
Letzte Erwähnung |
1956: √úbernahme; 1965: Umfirmierung |
| Zeit |
gesamt |
Arbeiter |
Angest. |
Lehrl. |
Kommentar |
| 1898 |
980 |
900 |
80 |
|
|
| 1905 |
3010 |
2804 |
206 |
|
|
| 1907 |
2206 |
|
|
|
vmtl. Neckarau + Rheinau |
Zeit = 1: Zeitpunkt unbekannt
| Zeit |
Bezug |
Abfolge |
andere Firma |
Kommentar |
| 1885 |
Umbenennung |
zuvor |
Rheinische Hartgummi-Waaren-Fabrik |
Rh. Hartgummi --> Rh. Celluloid [Braas: Kunststoff, gestern-heute-morgen (1973) 4/42] |
| 1965 |
Umbenennung |
danach |
Schildkröt AG, vorm. Rheinische Gummi- und Celloloid-Fabrik |
Rh. Celloloid --> Schildkröt [Braas: Kunststoff, gestern-heute-morgen (1973) 4/42] |
| 1 |
Nebenwerk |
danach |
Rheinische Gummi- und Celloloid-Fabrik, Nitrierwerk Rheinau |
|
| ZEIT | 1898 |
| THEMA | Entwicklung des Werks |
| TEXT | Im September 1885 wurde der Titel der Firma umge√§ndert in: "Rheinische Gummi & Celluloid Fabrik" Seit Anfang des Jahres 1886 wird das Etablissement ununterbrochen erweitert und erg√§nzt. Bald scheinen diese, bald jene R√§umlichkeiten unzul√§nglich oder aber den gestiegenen Anforderungen der Technik nicht mehr entsprechend; bald wurde diese, bald jene Maschine f√ľr verbesserungsbed√ľrftig oder gar veraltet erachtet. In vielen F√§llen wurden vorhandene, nicht einmal alte Geb√§ude geschleift und durch neue ersetzt, in anderen F√§llen konstruierte die Fabrik Spezialmaschinen auf Grund der in rastlosen Versuchen errungenen Fortschritte. Unter diesen Umst√§nden trat bereits im Jahre 1886 die Notwendigkeit heran, eine nicht unbedeutende Konstruktions- und Reparaturwerkst√§tte zu errichten mit den naturgem√§√ü zugeh√∂rigen Nebenbetrieben, als: Eisen- und Kupferschmiede, Schlosserei, Klempnerei, Schreinerei, Giesserei etc. und seitdem baut die Fabrik den gr√∂ssten Teil ihrer Spezialmaschinen selbst, oder l√§sst gr√∂√üere Maschinen nach eigenen Entw√ľrfen ausw√§rts arbeiten. Hierin ist wiederum die Erkl√§rung zu finden, dass unser Etablissement mit eigenen, allgemeinhin unbekannten Verfahren und Maschinen, die weder in der Literatur, noch in in- oder ausl√§ndischen beschrieben sind, arbeitet. Im Fr√ľhjahr 1888 wurde, zufolge Errichtung einer vollst√§ndig selbst√§ndigen Fabrik mit eigenem Kesselhaus und Dampfmaschinenanlage, die Fabrikation des Celluloids auch r√§umlieh von der alten Anlage f√ľr Hartgummi und Celluloidwaren gel√∂st.
Im Oktober 1888 trat Herr Adolf Bensinger in die Direktion unserer Gesellschaft ein, nachdem derselbe schon vorher eine Reihe von Jahren hindurch in unserem Betriebe t√§tig war. Im Sommer 1891 wurde unser Seniorchef Herr F. J. Bensinger durch allzu fr√ľhen Tod in seinem 50. Lebensjahre abgerufen. Schwer und unersetzlich ist sein Verlust.
Wehmut erf√ľllt uns, wenn wir seines tatenreichen Wirkens gedenken, wenn wir uns erinnern, durch welche zahlreiche und herbe Schicksalsschl√§ge er unser Werk zu dem gef√ľhrt hat, was es heute ist. Stark war seine Kraft und Gesundheit, st√§rker sein Wille und Manneswort. Die Zeiten vergehen; es erf√ľllen sich die Gesetze der Natur mit unerbittlicher H√§rte. M√∂gen diese Zeilen ein ehrendes Andenken des leider allzu fr√ľh Entschlafenen bei unseren Lesern hervorrufen, deren grosser Theil ihn pers√∂nlich kannte, m√∂ge sein Werk durch Jahre und Jahrzehnte hindurch beredter sein, als menschliche Worte! M√∂ge der stolze Titelname der Firma zu seinen Ehren auch f√ľrderhin genannt und bekannt bleiben, in nahen und fernen Landen. An dieser Stelle gedenken wir auch unseres ebenfalls fr√ľh dahingeschiedenen Mitbegr√ľnders Herrn A. Levy, sowie des im Dienste der Gesellschaft im Jahre 1888 durch j√§hen Tod dahingerafften Ingenieurs und Maschinenmeisters Herrn Julius Ries. Wir haben die Verdienste des Herrn A. Levy am Eingange dieses hervorgehoben; an ihm verlor die Gesellschaft einen gewandten und in der Hartgummibranche bewanderten, gediegenen Fachmann. Herr Ries, als Ingenieur und Konstrukteur gleich genial veranlagt, fand durch Umkippen eines in Montage befindlichen Maschinenschwungrades ein pl√∂tzliches und allseitig betrauertes Ende. Im April 1893 wurde Herr Carl Bensinger zum weiteren Vorstandsmitglied der Gesellschaft ernannt.
Am 15. October 1893 geruhte unser Landesf√ľrst Seine K. Hoheit, Grossherzog Friedrich von Baden das Unternehmen mit seinem allerh√∂chsten Besuch zu beehren. Seine K. Hoheit sprach seine allerh√∂chste Anerkennung aus. Nur Beharrung f√ľhrt zum Ziel, lehrt unser Motto. Das Unternehmen kann von sich behaupten, diese Sentenz bewahrheitet zu haben. Selten d√ľrfte ein Unternehmen unter schwierigeren Verh√§ltnissen begr√ľndet gewesen sein, selten hat das Schicksal, im Kampfe mit Wissensdrang und Tatkraft, die Bausteine menschlichen Schaffens mit mehr Beharrlichkeit und unerbittlicher Hand zerst√ľckelt und zerst√∂rt. Wenn trotzdem durch Beharrung und Energie das Werk zu dem herangedieh, was es heute ist, so gibt uns die kleine Rast, die wir uns am heutigen Tage g√∂nnen, ein doppeltes Anrecht darauf, uns mit Freude und Genugtuung des Gedeihens des Unternehmens und seiner derzeitigen Bl√ľte zu erinnern. In warmer Zuneigung gedenken wir daher der Gegenwart und aller derer, die zur Zeit unser Wirken treulich unterst√ľtzen, wie auch derer, die sich in gr√∂√üter Hingebung um unser Etablissement hohe Verdienste erworben haben und ihnen sei hierdurch ein herzliches Dankeswort dargebracht.
Wir besitzen heute bedeutende Warenniederlagen unter eigener Firma in Berlin, Paris, Wien, London, New-York, Oyonnax, sowie Nebendepots in St. Claude, Ruhla, Kreuznach etc. und ertretungen in allen gr√∂sseren St√§dten der Welt. Kreuz und quer durchsegeln die Erzeugnisse der Fabrik als Halb- und Ganzprodukte den Erdball. Zu weit w√ľrde es f√ľhren, die s√§mtlichen Verwendungsgebiete des Celluloids zu schildern, allein mit seinem Erfinder sagen wir heute, dass dieses herrliche Material sich in verh√§ltnism√§√üig kurzer Zeit in nahezu allen Branchen und allen L√§ndern Platz und Raum zu verschaffen wusste, w√§hrend sich unsere Gesellschaft ohne √úberhebung zu den gr√∂√üten der Branche, vielleicht zur gr√∂√üten der Welt rechnen kann. Der Grundbesitz unserer Fabrik bel√§uft sich zur Zeit auf rund 80.000 qm, wovon etwa ein Drittel zu Vergr√∂√üerungen vorgesehen ist.
Die Fabrikanlage selbst ist in drei von einander getrennte Fabrikationssparten eingeteilt, von welchen sich zwei in Neckarau und eine in Rheinau befindet. Die Arbeitsleistung erfolgt durch strikte Trennung in 4 Betriebe, von denen jeder einzelne seinen technischen Oberleiter und bezgl. Unterbeamten besitzt. Der erste Betrieb umfasst: Hartgummi, Hartgummiwaren, Celluloidwaren, sowie die Kamm-Industrie. Der zweite Betrieb: Technische Weichgummiwaren. Der dritte Betrieb: (Rheinau) Herstellung der Nitrocellulose. Der vierte Betrieb : Herstellung des Celluloids. Die treibende Kraft ist ausschlie√ülich Dampfkraft. Der Dampf zur Heizung und Kraft wird in 11 Dampfkesseln erzeugt, mit einer Gesamtheizfl√§che von 924 qm und 6 Dampfmaschinen, mit zusammen 1100 Pferdekr√§ften. Eine im September 1885 gegr√ľndete und sp√§ter vergr√∂√üerte elektrische Anlage besorgt die Beleuchtung; ca. 1200 Gl√ľhlampen sind dauernd im Gebrauch. In 141 durch Stra√üen, H√∂fe und Brandgiebel getrennten Bauten wird die Fabrikation vorgenommen. Kreuz und quer durchziehen unterirdische Wasser- und Dampfleitungen die Stra√üen und H√∂fe des Unternehmens. Die sehr betr√§chtliche Wasserversorgung wird aus vier Brunnen gewonnen und passiert zwei hohe Wassert√ľrme. An den verschiedensten Enden der Fabrik arbeiten reichliche Wasser- und Dampfpumpen in die Wasserspeicher, so dass bei Tag und Nacht bei eventuell ausbrechendem Feuer stets mehrere Pumpen betriebsbereit sind. 38 um die ganze Fabrikanlage verteilte Hydranten gestatten, rasch beliebige Mengen Wassers herbeizuholen. Da eine nicht gew√∂hnliche Gefahr in der ganzen Art der Verarbeitung des Gummi, sowie des Celluloids liegt, so werden sich unsere verehrten Leser wohl denken k√∂nnen, dass ein gen√ľgend geschultes Personal in F√§llen der Not hilfreich zur Hand ist. Die Einrichtungen des Feuerl√∂schwesens haben sich im Laufe der Zeit vorz√ľglich bew√§hrt und wenn auch kleine Br√§nde nie ganz zu vermeiden waren, so hatte die Fabrik doch seit jenem gro√üen Feuer 1885 unter erheblichen Schwierigkeiten in dieser Beziehung nicht mehr zu leiden.
Fachm√§nner wird es interessieren, dass die Fabrik z.Z. mit 64 Walzwerken und Kalandern arbeitet und dass 104 Pressen der verschiedensten Konstruktionen Ben√ľtzung finden, zur Erzeugung der ben√∂tigten Warenmengen. Zur Herstellung von K√§mmen allein sind 171 Kammschneidmaschinen dauernd im Betriebe. Der durchschnittliche Jahresverbrauch betr√§gt: an S√§uren ca. 2.300 Tonnen, an Kohlen ca. 6.500 Tonnen, an Alkohol √ľber 800.000 Liter. Seit Bestehen hat die Fabrik an Arbeitsl√∂hnen 6.000.000 Mark in bar ausbezahlt, hierzu kommen noch die Abgaben an technische und kaufm√§nnische Beamte der Zentrale und Filialen; z. Z. sind 79 derartige Beamten t√§tig. Im vergangenen Jahre betrug die durchschnittliche Zahl der Arbeiter und Beamten etwas √ľber 990.
Eine Fabrikkantine in Neckarau und eine solche in Rheinau versorgt die Arbeiter mit Speisen und Getr√§nken. Kohlen werden seit einigen Jahren zum Selbskostenpreise an die Arbeiter abgegeben, eine Erleichterung, die erfreulicherweise die weitgehendste Ben√ľtzung gefunden hat, was daraus erhellen d√ľrfte, dass im Laufe des Jahres 1897 allein von Seiten unserer Arbeiter 2076 Entnahmen mit zusammen 4528 Zentnern gemacht wurden. Die Fabrik hat einen Arbeiterunterst√ľtzungsfond, welcher reichlich dotiert ist und der durch einen allj√§hrlich durch die Arbeiter aus deren Mitte zu w√§hlenden Ausschuss verwaltet wird. Die Gesuche zur Unterst√ľtzung kommen diesem Ausschusse reichlich m√ľndlich und schriftlich zu und werden in den je nach Bedarf stattfindenden Sitzungen, von dem Ausschusse beschieden. Die Ausschussmitglieder m√ľssen s√§mtlich in unserer Fabrik t√§tig sein und daher kann rasche Hilfe, wenn n√∂tig sofort nach Einreichung des Gesuchs, gew√§hrt werden; da au√üerdem die Mitglieder mit den Verh√§ltnissen ihrer Kameraden und Nachbarn besser vertraut sind als irgend eine Korporation, so kann die Verteilung den tats√§chlichen Bed√ľrfnissen angemessen werden und insbesondere auch freiwillig an solche, die eine Unterst√ľtzung pers√∂nlich nicht nachsuchen. Im Jahre 1897 wurden 491 Unterst√ľtzungen im Gesamtbetrag von M. 3.323,81 gew√§hrt und zwar nicht immer in baarem Gelde, sondern auch je nach Bedarf in Form von Kleidungsst√ľcken, Naturalien etc. Ein selbst√§ndiger Krankenunterst√ľtzungsverein, welchem auch die kaufm√§nnischen und technischen Beamten angeh√∂ren, ist den Reichsgesetzen entsprechend organisiert. Dieser Verein erhebt sehr niedere Beitr√§ge, da derselbe das Verm√∂gen der fr√ľher bestandenen Fabrikkrankenkasse √ľbernommen hat und daher √ľber reiche Reserven verf√ľgt.
Denkw√ľrdig ist der heutige Tag und denkw√ľrdig m√∂ge er in unserer Erinnerung bleiben: mit ihm verschwindet und beginnt ein neuer Lebensabschnitt gemeinsamer Arbeit. M√∂ge es uns verg√∂nnt sein, in dem Kreise unserer heutigen Angestellten und Beamten, fort und fort noch Jahre hindurch in bisherigem Sinne zu schaffen und zu wirken, zum Frommen und Stolz der deutschen hochaufstrebenden Industrie! |
| QUELLE | [Zum 25jährigen Jubiläum der Rheinischen Gummi- und Celluloidfabrik (1898)] |
|