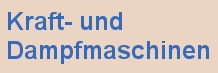| Zeit |
Ereignis |
| 1863 |
Peter Emil Huber-Werdm├╝ller (* 24.12.1836, + 04.10.1915) gr├╝ndet in Oerlikon bei Z├╝rich das "Schmiede- und Walzwerk P. E. Huber & Co." |
| 1868 |
Stillegung des Werkes und Liquidation der Firma |
| 1872 |
├ťbernahme der Werksanlagen durch die Firma "Daverio Siewerdt & Giesker" mit P.E. Huber als Teilhaber |
| 1876 |
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft als "Aktien-Gesellschaft der Werkzeug- und Maschinenfabrik Oerlikon" |
| 1885 |
Charles Eug├Ęne Lancelot Brown (* 17.06.1863, + 02.05.1924), Sohn von Charles Brown, ├╝bernimmt die Leitung der Maschinenfabrik Oerlikon, er nimmt den Elektromaschinenbau auf |
| 1885 |
Boveri wird Volont├Ąr und kurz darauf Montageleiter f├╝r elektrische Anlagen bei der Maschinenfabrik Oerlikon, dort Bekanntschaft mit Charles Eugen Lancelot Brown. |
| 1886 |
Umfirmierung in "Maschinenfabrik Oerlikon" |
| Winter 1890/91 |
Die Maschinenfabrik Oerlikon unter F├╝hrung ihres Chefelektrikers C. E. L. Brown l├Ą├čt auf dem Fabrikhof eine Drehstrom├╝bertragungsanlage errichten und f├╝hrt an ihr im Winter 1890/91 Versuche mit Spannungen bis zu 30.000 Volt aus, auch unter k├╝nstlicher Beregnung. |
| 1891 |
Die MFO und die AEG schaffen auf die Initiative Oskar von Millers hin zwischen Lauffen bei Heilbronn und Frankfurt am Main die erste Drehstromfern├╝bertragung. Mit diesem bedeutenden Experiment wird ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur fl├Ąchendeckenden Elektrifizierung in Deutschland unternommen. |
| 1891 |
Nach dem Ausscheiden von Charles Eugene Lancelot Brown als Chefelektriker bei der Maschinenfabrik Oerlikon wird E. Arnold sein Nachfolger |
| 1891 |
Charles Eugene Lancelot Brown scheidet als Chefelektriker bei der Maschinenfabrik Oerlikon aus |
| 24.01.1891 |
Die unter F├╝hrung ihres Chefelektrikers C. E. L. Brown entstandene Hochspannungs├╝bertragungsanlage f├╝r Spannungen bis zu 30.000 Volt wird auf Veranlassung von Oskar von Miller durch Vertreter der Deutschen Reichspost, der preu├čischen und W├╝rttembergischen Staatsbahnen sowie von Mitgliedern des Frankfurter Ausstellungskommitees besichtigt. Die Besichtigung bringt einen vollen Erfolg: Die Postverwaltung und die beteiligten L├Ąnder W├╝rttemberg, Baden, Hessen und Preu├čen erkl├Ąren sich mit dem Bau einer Kraft├╝bertragungsanlage einverstanden. |
| 1892 |
Hans Behn-Eschenburg beginnt seine T├Ątigkeit bei der Maschinenfabrik Oerlikon. |
| 1895 |
C. E. L. Brown scheidet um 1895 aus und gr├╝ndet mit Walter Boveri die Firma "Brown, Boveri & Cie." |
| 1897 |
H. Behn-Eschenburg wird Chefelektriker bei der MFO |
| 1903 |
Ingenieur H. Behn-Eschenburg der Maschinenfabrik Oerlikon/Schweiz gelingt es, den Kommutatormotor durch die Einf├╝hrung des ohmschen Wendepol-Shunts auch f├╝r Wechselstromspeisung brauchbar zu machen. Durch die Verdrehung des Wendepolfelds gelingt es, im Bereich der meistgenutzten Fahrgeschwindigkeit die Transformationsspannung im Anker und damit das B├╝rstenfeuer zu unterdr├╝cken. |
| 1904 |
Einsatz des Einphasen-Wechselstrommotors mit phasenverschobenem Wechselfeld durch die MFO nach Behn-Eschenburg (1904-09 Versuchsbetrieb Seebach-Wettingen) |
| 1911 |
H. Behn-Eschenburg, bisher Chefelektriker, wird Direktor bei der MFO |
| 1913 |
H. Behn-Eschenburg steigt vom Direktor bei der MFO zum technischen Generaldirektor auf. |
| 1919 |
Behn-Eschenburg tritt in den Verwaltungsrat der MFO ein. |
| 1928 |
Ende der T├Ątigkeit von Behn-Eschenburg als technischer Generaldirektor der MFO |
| 1937 |
Umfirmierung in "Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon - B├╝hrle & Co." |
| 1938 |
Behn-Eschenburg scheidet aus den Verwaltungsrat der MFO aus. |
| 1967 |
├ťbernahme durch die Brown, Boveri & Cie. |
| 1970 |
Umwandlung in eine Verm├Âgensverwaltungsgesellschaft |
| 1992 |
Noch existent, der Bau von elektrischen Anlagen ist im ABB-Konzern aufgegangen |