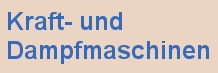|
|
Zuckerfabrik Frankenthal, Fabrik Friedensau
| Firmenname | Zuckerfabrik Frankenthal, Fabrik Friedensau |
| Ortssitz | Friedensau (Pfalz) |
| Postleitzahl | 67112 |
| Art des Unternehmens | Zuckerfabrik |
| Anmerkungen | Gegr. 1851 von Carl Gottlob Reihlen (vmtl. unter dieser Firma). 1900: "Zuckerfabrik Friedensau AG". An der Gemarkungsgrenze von Mutterstadt zu Neuhofen. Friedensau gehört spÀter zu Limburgerhof. Der Rohzucker wurde nach Frankenthal zur Raffination transportiert. Hat um 1885 Gasbeleuchtung. Reinigung mit Lux Masse. Seit 1886 zur Zuckerfabrik Frankenthal (s.d.). |
| Quellenangaben | [Reichs-AdreĂbuch (1900) 526] [Verz Zuckerfabr (1900), AdreĂbuch Zuckerind (1912)] [Pohl: SĂŒdzucker (1987) 35] [Das gedenkt mir noch (1980) 75] [Bericht PfĂ€lz. Industrie-Ausstellung (1861) 160] |
| Zeit |
Ereignis |
| 01.05.1851 |
Errichtet von Carl Gottlob Reihlen. Er teilt den GeschĂ€ftsfreunden am 1. Mai in einem Rundschreiben mit, eine RĂŒbenzuckerfabrik in "Rhainbaiern" bei Mutterstadt zu bauen |
| Dez. 1851 |
Inbetriebnahme |
| 1855 |
Erbaut von der SangerhÀuser Maschinenfabrik [doch schon seit 1851 in Betrieb!] |
| 06.06.1857 |
Baubeginn (?) einer Dampfmaschine durch G. Kuhn, Stuttgart-Berg. |
| 1867 |
Zusammen mit den Zuckerfabriken Regensburg, Böblingen, Stuttgart, Heilbronn, ZĂŒttlingen, Altshausen, WaghĂ€usel und Frankenthal wird der Zweigverein SĂŒddeutscher Zuckerfabriken gegrĂŒndet. |
| 1886 |
Ăbernahme durch die Zuckerfabrik Frankenthal |
| 1887 |
Ăbernahme durch die Zuckerfabrik Frankenthal |
| 1892 |
umgebaut von der SangerhÀuser Maschinenfabrik |
| 1892 |
Wiederinbetriebnahme der stillegelegten Fabrik |
| 1902 |
Ăbernahme der Zuckerfabrik Gernsheim |
| 1932 |
Bis zu diesem Jahr wird der Betrieb durch die Zuckerfabrik Frankenthal bzw. die SĂŒddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft gefĂŒhrt und 1932 stillgelegt |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Rohzucker |
1852 |
vmtl. seit Inbetriebnahme |
1932 |
Ende |
|
| Bezeichnung |
Bauzeit |
Hersteller |
| Dampffeuerspritze |
1908 |
Waggon- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft vorm. Busch |
| Dampfmaschine |
06.06.1857 |
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und GelbgieĂerei von G. Kuhn |
| Zeit |
Objekt |
Anz. |
Betriebsteil |
Hersteller |
Kennwert |
Wert |
[...] |
Beschreibung |
Verwendung |
| 1860 |
Dampfkessel |
6 |
|
unbekannt |
GesamtheizflÀche entspr. |
200 |
PS |
|
|
| 1860 |
Dampfmaschinen |
6 |
|
unbekannt |
Gesamtleistung |
44 |
PS |
|
|
| Zeit |
gesamt |
Arbeiter |
Angest. |
Lehrl. |
Kommentar |
| 1860 |
260 |
|
|
|
Im Sommer fĂŒr Fabrik- und Feldarbeit: 110, im Herbst beim RĂŒben-Empfang: 350, wĂ€hrend der Kampagne: 260 |
| von |
bis |
Produkt |
im Jahr |
am Tag |
Einheit |
| 1899 |
|
ZuckerrĂŒben |
|
500 |
t |
| 1910 |
|
ZuckerrĂŒben |
|
900 |
t |
| 1926 |
|
ZuckerrĂŒben |
|
1200 |
t |
| 1927 |
|
ZuckerrĂŒben |
|
1200 |
t |
| 1928 |
|
ZuckerrĂŒben |
|
1300 |
t |
| 1929 |
|
ZuckerrĂŒben |
|
1500 |
t |
Zeit = 1: Zeitpunkt unbekannt
| Zeit |
Bezug |
Abfolge |
andere Firma |
Kommentar |
| 1886 |
Nebenwerk |
zuvor |
Zuckerfabrik Frankenthal |
|
| ZEIT | 1860 |
| THEMA | auf der Ausstellung Kaiserslautern |
| TEXT | In erster Linie ist es die Fabrik von Johann Conrad Neihlen in Friedensau, welcher das Verdienst gebĂŒhrt, nicht nur in allen Teilen der Fabrikation sich der als die vollkommensten geltenden Arten des Verfahrens zu bedienen, sondern auch höchst wichtige Verbesserungen derselben erfunden nnd eingefĂŒhrt zu haben. Der Name Heinrich Frickenhaus,
des beteiligten Schwiegersohnes des Chefs der Firma, ist derjenige einer AutoritĂ€t in der RĂŒbenzuckerfabrikation. Das von diesem im Jahre 1854 erfundene Verfahren der Saftgewinnung, mittels Zentrifugen und Mazeration zugleich, liefert die gröĂte Saftausbeute (90 bis 92 Prozent) nnd erlaubt die direkte und demnach wohlfeilste Verarbeitung des
RĂŒbensaftes auf Melis. Dieses Verfahren hat seitdem im Zollverein, Ăsterreich und RuĂland Verbreitung gefunden. In Belgien steht der Besteuerungsmodus der EinfĂŒhrung entgegen. Das Frickenhaus'sche Verfahren beim Scheiden des Saftes, bestehend in Verwendung eines Zusatzes von Braunstein zum Kalk, hat sich gleichfalls als Ă€uĂerst vorteilhaft
bewÀhrt. Infolge AnhÀufung der aus der Fabrikation residuierenden Melasse ergab sich spÀter die Notwendigkeit der Errichtung einer Melasse-Brennerei. Die so sich gegenseitig ergÀnzenden Einrichtungen ermöglichen die Verarbeitung
von tĂ€glich 1200 Ctr. RĂŒben und die gleichzeitige Produktion von 800 Liter Sprit. In den beiden letzten Kampagnen, welche unter den gegenwĂ€rtigen VerhĂ€ltnissen auf nur 2 Monate, statt auf 6 ausgedehnt waren, betrug das verarbeitete RĂŒbenquantum nur 56.000 Ctr., statt der Fabrikeinrichtung entsprechend 180.000. Die ZuckerrĂŒben werden teils auf dem
zur Fabrik gehörigen Ackerlande erzeugt, teils aus der nĂ€chsten Umgegend angekauft. Unter UmstĂ€nden wird auch fertiger Rohzucker aus preuĂisch Sachsen bezogen und zu Melis raffiniert, desgleichen Melasse aus sĂŒddeutschen Fabriken fĂŒr die Brennerei. Zucker wird nur als Melis fabriziert. Die hauptsĂ€chlichsten Arbeitsmaschinen bestehen in 12 Zentrifugen mit Einrichtungen zu Maceration. In der Brennerei ist ein Apparat nach Pistorius-Bollmann in Gebrauch. Die nötige Betriebskraft liefern 6 Dampfmaschinen von zusammen 44 PS, 6 Dampfkessel von einer 200 PS
entsprechenden HeizflĂ€che versorgen diese Maschinen und alle zu heizenden Apparate. Die Zahl der Arbeiter und Arbeiterinnen betrĂ€gt im Sommer fĂŒr Fabrik- und Feldarbeit: 110, im Herbst beim Empfang der RĂŒben: 350, im Winter wĂ€hrend der Kampagne: 260. Der produzierte Melis wird in der Pfalz, Baden und WĂŒrtemberg, der Spiritus in denselben
LĂ€ndern nebst Frankreich und der Schweiz abgesetzt. |
| QUELLE | [Bericht ĂŒber die PfĂ€lzische Industrie-Ausstellung zu Kaiserslautern (1860) 160] |
|