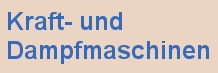|
|
Adlerwerke vorm. H. Kleyer Aktiengesellschaft
| Firmenname | Adlerwerke vorm. H. Kleyer Aktiengesellschaft |
| Ortssitz | Frankfurt (Main) |
| StraĂe | Kleyerstr. 17 |
| Postleitzahl | 60326 |
| Art des Unternehmens | Fahrrad-, Auto, BĂŒromaschinenfabrik |
| Anmerkungen | Bis 1906: "Adler-Fahrradwerke vorm. ...". 1900: Gutleutstr. 9. [FAZ]: 1957 / [Wikipedia]: 1959 / [Schirmbeck]: ab 1966 "Triumph-Adler BĂŒromaschinen-Vertriebsgesellschaft" (ausschlieĂlich BĂŒromaschinenproduktion). |
| Quellenangaben | [Masch-Ind Dt Reich (1939/40) 363] [Reichs-AdreĂbuch (1900) 1707] [Schirmbeck: Route Industriekultur (2003) 68] Wikipedia |
| Zeit |
Ereignis |
| 1880 |
GrĂŒndung der Ursprungsfirma "Heinrich Kleyer" von Kommerzienrat Dr.-Ing. h. c. Heinrich Kleyer in Frankfurt (Main) als Maschinen- und Velociped-Handlung in der Gutleutstr. 9. |
| 1881 |
Seine ersten FahrrĂ€der (1881-85) lĂ€Ăt Heinrich Kieyer in einer Frankfurter Maschinenfabrik herstellen. |
| 1886 |
Heinrich Kleyer grĂŒndet die Adler-Fahrradwerke. Er beginnt nach eigenen Ideen mit der Selbstfabrikation von FahrrĂ€dern. |
| 1889 |
Heinrich Kleyer errichtet eine mit allen Mitteln der modernen Technik ausgestattete, zunĂ€chst fĂŒr 600 Arbeiter berechnete Fabrik im Frankfurter Gallusviertel zwischen Höchster StraĂe (spĂ€ter: KleyerstraĂe) und Weilburger StraĂe auf einem Areal von 18.000 Quadratmetern. |
| 05.07.1895 |
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft unter Ăbernahme der seit 1880 bestehenden Firma Heinrich Kleyer in Frankfurt (Main) mit einem Grundkapital von M 2.500.000,00 als "Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer A.-G." |
| 1896 |
Heinrich Kleyer erwirbt die Patente an der "Empire"-Schreibmaschine (in Montreal gebaut). ZunÀchst werden etwa 3000 Exemplare unter der Bezeichnung "Deutsche Empire" gebaut. |
| 1897 |
An der Hoechster StraĂe entsteht der siebengeschossige Fabrikhochbau, in dem fortan auch Schreibmaschinen produziert werden. |
| 1898 |
Beginn des Schreibmaschinenbaues im neuen siebengeschossigen Fabrikhochhau an der Weilburger StraĂe |
| 1898 |
Es wird eine Dividende von 20 Prozent gezahlt. |
| 1899 |
Die ersten Adler-Versuchsfahrzeuge datieren von 1899: eine leichte Voiturette mit de Dion-Motor |
| 1900 |
H. Kleyer entschlieĂt sich, Automobile zu konstruieren. Der Bau von Automobilen wird aufgenommen. |
| 1901 |
Die Schreibmaschinen-Bezeichnung "Deutsche Empire" wird erst 1901 in "Adler 7" geĂ€ndert. Sehr groĂe Verkaufserfolge. |
| 1901 |
Es werden auch MotorrÀder mit De-Dion-Motoren gebaut |
| 1902 |
Adler engagiert den österreichischen Ingenieur Edmund Rumpler |
| 1902 |
Alfred Teves wird AutomobilverkÀufer der Firma "Adler" in Frankfurt (Main) |
| 1902 |
Der Schriftsteller Otto Julius Bierbaum mit einem Adler-8-PS-Wagen eine Italienreise, die er in dem Buch "Eine empfindsame Reise im Automobil" beschreibt. |
| 1903 |
Der junge Ingenieur Edmund Rumpler kommt zu den Adler-Werken und ĂŒbernimmt das KonstruktionsbĂŒro. Er entwickelt die ersten eigenen Motoren. |
| Ende 1904 |
Es wird ein Abkommen mit der französischen Automobilfabrik Clement-Bayard abgeschlossen |
| 1905 |
Die Adler-Automodelle erhalten Stahlblechfahrgestelle |
| 1905 |
Die Adler-Automodelle erhalten geschmiedete Vorderachsen |
| 1905 |
Die Adler-Automodelle erhalten Schraubenspindellenkung |
| 1905 |
Adler ist der erste deutsche Autohersteller, der Motor und Getriebe miteinander verblockt. |
| 09.06.1905 |
Baubeginn (?) einer Dampfmaschine durch Kuhn/Maschinenfabrik Esslingen. |
| 1906 |
Umbennenung der "Adler-Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer" in "Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer Aktiengesellschaft" |
| 1907 |
August Kremer, Mannheim, bringt in ihren GeschÀftsrÀumen in P 7, 8 und 19 Fabrikate der Adlerwerke zur Aufstellung |
| ab 1907 |
Bis nach dem Zweiten Weltkrieg werden keine MotorrÀder mehr hergestellt. |
| 11.03.1907 |
Ănderung der Firma aus "Adler Fahrradwerke vorm. Heinrich Kleyer A.-G." in "Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer Aktiengesellschaft" |
| 1909 |
Das Unternehmen stellt Prototypen von Luftschiffmotoren vor. |
| 1912 |
Bau einer monumentalen Fabrikanlage in historisierenden Formen mit zinnenbewehrten TĂŒrmen in drei Bauabschnitten |
| 1914 |
20 Prozent der in Deutschland zugelassenen Personenwagen wurden von Adler gebaut. |
| 1919 |
Die vor dem Kriege 1914-1918 durchaus gĂŒnstige Entwicklung wird durch die Schwierigkeiten, die sich nach dem Kriege namentlich der Automobilindustrie entgegenstellen, beeinfluĂt. |
| 1926 |
Der Adler Standard 6 mit Sechszylinder-Reihenmotor wird vorgestellt. Das am Chrysler 60 orientierte Modell hat als erster deutscher Pkw eine von ATE mit Lockheed-Lizenz gebaute hydraulische Bremsanlage. Zusammen mit der komplett aus Stahlblech hergestellten Karosserie kann der Standard 6 so den Entwicklungsvorsprung der seinerzeit in Europa sehr gefragten US-amerikanischen Fahrzeuge aufholen. |
| 1928/29 |
Der "Favorit" wird vorgestellt |
| 1928 |
Der PKW "Standard 8" mit Stahlblech hergestellten Karosserie und hydraulischer Bremsanlage und mit Achtzylinder-Reihenmotor kommt heraus. |
| 01.05.1929 |
In der Hauptversammlung vom 1. Mai 1929 wird zwecks Beseitigung der Unterbilanz und Vornahme auĂerordentlicher Abschreibungen die Herabsetzung des Grundkapitals von RM 19.271.000,00 auf RM 9.635.500,00 beschlossen. Die gleiche Hauptversammlung beschlieĂt die Wiedererhöhung des Stammaktienkapitals um nom. Reichsmark 15.375.000,00 auf RM 25.000.000,00 und des Vorzugsaktienkapitals um nom. RM 10.500,00 auf RM 21.000,00. |
| 1930 |
Der ehemalige Leiter des Bauhauses, Walter Gropius, wird Berater der Firmenleitung und entwirft neben Karosserien auch das Markenzeichen neu. Diese Zusammenarbeit wird wegweisend und macht die die "Kubuslimousine" zum neuen Inbegriff. |
| 1931 |
Hans Gustav Röhr wird nach dem Konkurs seines eigenen Unternehmens Konstrukteur bei den Adlerwerken. |
| 1932 |
Die Adlerwerke bestellen bei Karmann in OsnabrĂŒck fĂŒr Modell "Primus" 800 Cabriolets. |
| 1932 |
Der von Hans Gustav Röhr entwickelte "Adler Trumpf" wird vorgestellt: Ein Mittelklassefahrzeug mit EinzelaufhÀngung aller RÀder und (zu dieser Zeit noch ungewöhnlichem) Frontantrieb. |
| bis 1934 |
In acht Jahren setzt Adler von dem Erfolgsmodell "Standard 6" knapp 30.000 Wagen ab. |
| 1934 |
Der frontgetriebene Kleinwagen "Adler Trumpf Junior" kommt heraus. |
| 31.07.1934 |
Die Hauptversammlung vom 31. Juli 1934 beschlieĂt die Auflösung des gesetzlichen Reservefonds von RM 750.000,00 und eine Kapitalherabsetzung in erleichterter Form in der Weise, daĂ die im eigenen Besitz befindlichen nom. Reichsmark 332.200,00 Stammaktien eingezogen und das hiernach verbleibende Stammaktienkapital von RM 24.667.800,00 im VerhĂ€ltnis 2 : 1 auf RM 12.333.900,00 zusammengelegt wird. Die gleiche Hauptversammlung beschlieĂt ferner, das herabgesetzte Stammaktienkapital unter AusschluĂ des gesetzlichen Bezugsrechtes der AktionĂ€re um RM 2.645.100,00 zu erhöhen und die nom. RM 21.000,00 Vorzugsaktien in Stammaktien umzuwandeln. Hiernach betrĂ€gt das Stammkapital RM 15.000.000,00. |
| 1935 |
Hans Gustav Röhr ist bis 1935 Konstrukteur bei Adler. |
| 1935 |
Adler trennt sich von dem Luftfahrtbetrieb Flugzeugbau Max Gerner |
| 11.1935 |
Der von Steyr Daimler Puch kommende Karl Jenschke wird Chefkonstrukteur. - Er entwickelt den Adler 2,5 Liter Autobahnwagen mit neuartiger Stromlinienform. |
| 1938 |
Adler konstruiert einen Achtzylinder-PKW |
| bis 1939 |
Von Kleinwagen "Adler Trumpf Junior" werden innerhalb von fĂŒnf Jahren ĂŒber 100.000 Exemplare verkauft. |
| 28.04.1942 |
Laut AufsichtsratsbeschluĂ vom 28. April 1942 Kapitalberichtigung gemÀà DAV vom 12. Juni 1941 um 20 % = RM 3.000.000,00 auf RM 18.000.000,00 durch Zuschreibungen zu den Anlagewerten zum Zwecke der Offenlegung stiller Reserven wird das Anlagevermögen um weitere RM 2.000.000,00 erhöht. Aus diesem Betrage werden RM 500.000,00 der gesetzlichen und RM 1.500.000,00 der freien RĂŒcklage zugefĂŒhrt. |
| 16.06.1943 |
Letzte ordentliche Hauptversammlung bis 1943/44 |
| 22.03.1944 |
Das Werk wird bei einem Luftangriff auf Frankfurt schwer beschĂ€digt. - In der Folge werden groĂe Teile der Produktion ausgelagert. Die Fertigung von Fahrgestellen fĂŒr Halbkettenfahrzeuge (Sd.Kfz. 10 und 11) und Motoren verbleibt aber vor Ort. ArbeitskrĂ€fte fehlten, selbst Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen stehen nicht mehr zur VerfĂŒgung. Daher beantragt die Unternehmensleitung von Wirtschaftsverwaltungshauptamt die Zuweisung von KZ-HĂ€ftlingen. Die bewilligten HĂ€ftlinge werden auf dem GelĂ€nde im Werk I an der Weilburger StraĂe untergebracht. |
| 1948 |
Generaldirektor Ernst Hagemeier verhindert nach seiner RĂŒckkehr aus der Internierung die Wiederaufnahme des Automobilbaus. |
| 1949 |
Wiederaufnahme der Motorradproduktion |
| 1955 |
Der Motorroller "Adler Junior" mit 100 ccm kommt ins Programm |
| 1957 |
Max Grundig kauft das Aktienkapital der Triumph-Werke NĂŒrnberg sowie eine Beteiligung an den Adlerwerken, was das Aus fĂŒr die Adler-Motorradfertigung bedeutet. |
| 1958 |
Die Produktion der "Tippa"-Schreibmaschinen von Gossen (Erlangen) geht auf "Adler" ĂŒber |
| 1958 |
Grundig schlieĂt die Triumph-Werke NĂŒrnberg, die Adlerwerke sowie den DiktiergerĂ€te-Bereich (Grundig-Stenorette) seiner Grundig-TonbandgerĂ€tewerke zur "Triumph-Adler BĂŒromaschinen-Vertriebsgesellschaft" zusammen und produziert fortan nur noch BĂŒromaschinen. |
| 1993 |
Olivetti verkauft die weiterhin börsennotierten Adlerwerke mit dem gesamten historischen WerksgelÀnde in Frankfurt an die Immobilieninvestor Roland Ernst und den Baukonzern Philipp Holzmann. |
| 1998 |
Die Schreibmaschinenproduktion wird eingestellt. |
| 1999 |
Die "HBAG Real Estate" (vormals "KĂŒhltransit AG") ĂŒbernimmt von der finanziell angeschlagenen Philipp Holzmann 98,3% der Aktien der Adlerwerke. |
| 2002 |
Die Adlerwerke firmieren in "Adler Real Estate" um und sind seitdem in der Immobilienprojektentwicklung tÀtig. |
| 2005 |
"Adler Real Estate" ist seither mehrheitlich in Hand eines US-amerikanischen Fonds. |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Apparate, Werkzeuge |
1939 |
[Masch-Ind Dt Reich (1939/40) 363] |
1939 |
[Masch-Ind Dt Reich (1939/40) 363] |
|
| BĂŒromaschinen |
1898 |
Beginn der Schreibmaschinenproduktion |
1939 |
[Masch-Ind Dt Reich (1939/40) 363] |
|
| FahrrÀder |
1886 |
Beginn der Eigenproduktion |
1939 |
[Masch-Ind Dt Reich (1939/40) 363] |
|
| MotorfahrrÀder |
1939 |
[Masch-Ind Dt Reich (1939/40) 363] |
1939 |
[Masch-Ind Dt Reich (1939/40) 363] |
|
| Personenkraftwagen |
1900 |
Beginn |
1939 |
Umstellung auf Schreibmaschinen-Herstellung |
|
| Schreibmaschinen |
1898 |
Beginn |
1939 |
[Masch-Ind Dt Reich (1939/40) 363] |
|
| Bezeichnung |
Bauzeit |
Hersteller |
| Dampfmaschine |
06.1905 |
Maschinen- und Kessel-Fabrik, Eisen- und GelbgieĂerei von G. Kuhn |
| Zeit |
Betr.-Teil |
FlÀche |
bebaut |
Gleis |
Whs |
Betr. in |
Kommentar |
| 1939 |
gesamt |
200000 |
|
|
|
|
|
| 1939 |
Werk I |
|
|
|
|
|
|
| 1939 |
Werk II |
|
|
|
|
|
|
| 1939 |
Werk III |
|
|
|
|
|
|
| 1939 |
Werk IV |
|
|
|
|
|
|
| Zeit |
gesamt |
Arbeiter |
Angest. |
Lehrl. |
Kommentar |
| 1889 |
600 |
|
|
|
Die neue Fabrik auf 600 Arbeiter berechnet |
| 1922 |
10000 |
|
|
|
4 Jahre nach dem 1. WK |
| 1930 |
3000 |
|
|
|
|
| 1935 |
6635 |
|
|
|
|
| 1936 |
6834 |
|
|
|
|
| 1937 |
6919 |
|
|
|
|
| 1938 |
7570 |
|
|
|
|
| ZEIT | 1943 |
| THEMA | Organe und Kapital der Gesellschaft |
| TEXT | Vorstand: Direktor Ernst Hagemeier, Frankfuit (Main), Vorsitzer; Direktor Otto Basson, Frankfurt (Main); Direktor Rosleff Sörensen, Frankfurt (Main); stellv. Direktor Franz Gessner, Frankfurt (Main); stellv. Direktor Dr. sc. pol. Gotthard Romberg, Frankfurt (Main). Aufsichtsrat: Carl Goetz, Vorsitzer des Aufsichtsrates der Dresdner Bank, Berlin, Vorsitzer; Kurt Freiherr von Schröder, Mitinhaber des Bankhauses J. H. Stein, Köln, stellv. Vorsitzer; Karl Eckardt, Generaldirektor der Schuhfabriken J. & C. A. Schneider, Frankfurt (Main); Dipl.-Ing. Edgar Haverbeck, WehrwirtschaftsfĂŒhrer, Vorstandsmitglied der Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken A.-G., Berlin; Erwin Kleyer, Berlin-Wilmersdorf; Dr.-Ing. e. h. Carl Köttgen, Berlin-Siemensstadt; Gustav Wilhelm von Mallinckrodt, Berlin; Heinrich Möring, Vorstandsmitglied der AEG, Berlin-Grunewald; Georg O. Rienecker, Frankfurt (Main); Hermann Schlosser, Vorsitzer des Vorstandes der Deutschen Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt (Main); Dr. Hermann Tepe, Direktor der Hallescher Bankverein K. a. A., Berlin. AbschluĂprĂŒfer fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 1943: Treuhand-Vereinigung Aktiengesellschaft, Berlin, Zweigniederlassung Frankfurt (Main). GeschĂ€ftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember. Hauptversammlung (Stimmrecht): Je nom. RM 100,00 Stammaktie l Stimme. Reingewinn-Verwendung: Der Reingewinn der Gesellschaft, der sich nach Vornahme von Abschreibungen, Wertberichtigungen, RĂŒckstellungen und RĂŒcklagen ergibt, wird wie folgt verteilt: 1. ZunĂ€chst erhalten die AktionĂ€re bis zu 4% des auf ihre Aktien eingezahlten Betrages; 2. der Rest wird an die AktionĂ€re verteilt, wenn nicht die Hauptversammlung etwas anderes beschlieĂt. Grundkapital: nom. RM 18.000.000,00 Stammaktien in 8 750 StĂŒcken B zu je RM 100,00 (Nr. 1-8750), 7 450 StĂŒcken A zu je RM 500,00 (Nr. zw. 1-23 500), 13 400 StĂŒcken C zu je RM 1.000,00 (Nr. 1-13 400). |
| QUELLE | [Handbuch Akt.-Ges. (1943) 3905] |
| |
| ZEIT | 1943 |
| THEMA | Zweck und Gegenstand des Unternehmens |
| TEXT | Gegenstand des Unternehmens: Herstellung und Vertrieb von Kraftfahrzeugen, BĂŒromaschinen, FahrrĂ€dern, Maschinen, Apparaten, Werkzeugen, Bestandteilen und ZubehörstĂŒcken hierzu, ferner Betrieb sonstiger gewerblicher Unternehmen und Vertrieb ihrer Erzeugnisse. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu unterhalten und sich bei anderen Gesellschaften oder Unternehmen zu beteiligen und deren Betrieb zu ĂŒbernehmen. Niederlassungen: In Berlin, Breslau, DĂŒsseldorf, Essen, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Kattowitz, Königsberg (Pr), Leipzig, Mannheim, MĂŒnchen, NĂŒrnberg und Stuttgart. Vertretungen: An den HauptplĂ€tzen der Welt. Erzeugnisse: FahrrĂ€der, MotorfahrrĂ€der und sonstige Fahrzeuge, Automobile, Last- und Lieferwagen, Apparate und Werkzeuge, Schreibmaschinen (mit StoĂstangen und Schwinghebeln), Buchungsmaschinen. |
| QUELLE | [Handbuch Akt.-Ges. (1943) 3905] |
| |
| ZEIT | 1943 |
| THEMA | BesitzverhÀltnisse |
| TEXT | Besitz- und Betriebsbeschreibung: Der Grundbesitz der Gesellschaft verteilt sich auf das FabrikgrundstĂŒck und vier WohngrundstĂŒcke in Frankfurt (Main); ferner auf Breslau, DĂŒsseldorf, Hamburg, Hannover, Königsberg (Pr), Leipzig, MĂŒnchen, NĂŒrnberg und Stuttgart. Die bebauten auswĂ€rtigen GrundstĂŒcke sind, soweit sie nicht fĂŒr die Unterbringung der Filialbetriebe benötigt werden, vermietet. Eigene Werkstattbauten auf gemietetem Grund und Boden befinden sich in Berlin und NĂŒrnberg. Von den der Herstellung der Fabrikate der Gesellschaft dienenden Abteilungen sind in der Hauptsache zu nennen: Mechanische WerkstĂ€tten einschlieĂlich der zugehörigen Nebenbetriebe, wie HĂ€rterei, Stanzerei, Vernickelei, Verchromerei, SchweiĂerei sowie Schmiede, Montageabteilungen, Karosserielagerung, Lackieranlagen, Werkzeugbau, Automobilreparaturabteilung, Automobilzubehör- und Ersatzteillager, SonderanfertigungswerkstĂ€tten, Versuchs- und Kontrollabteilungen. |
| QUELLE | [Handbuch Akt.-Ges. (1943) 3905] |
| |
| ZEIT | 1943 |
| THEMA | Beteiligung an folgenden Unternehmens |
| TEXT | Beteiligungen: 1. Selbstfahrer Union G. m. b. H., Hamburg, Beteiligung: 30 % = nom. RM 9.000,00; 2. Exportgemeinschaft Deutscher Automobilfabriken A.-G. (in Abwicklung), Berlin, Beteiligung: 10 % = nom. RM 10.000,00; 3. OPTIMA Handels-A.-G., Agram, Beteiligung: 100 %; 4. Exportdienst deutscher Automobilfabriken G. m. b. H., Berlin, Beteiligung: 5 % = nom. RM 15 000.4-. Buchwert der Beteiligungen: RM 1,00. Buchwert der Wertpapiere: RM 5.450.000,00. |
| QUELLE | [Handbuch Akt.-Ges. (1943) 3905] |
|