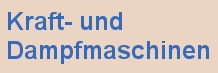|
|
Elektricitätswerk an der Lungwitz
| Firmenname | Elektricitätswerk an der Lungwitz |
| Ortssitz | Oberlungwitz (Sachs) |
| Art des Unternehmens | Elektrizitätswerk |
| Anmerkungen | Erbaut von der AEG. Auch bezeichnet als "Überlandzentrale Elektrizitätswerk an der Lungwitz". 1913: Dreileiter-Gleichstromwerk, 1900/05 betrieben mit Kolbendampfmaschinen und Wasserkraft, 1908/20: Dampfturbinen. Maschinenleistung (1913): 4029 PS, 64 kW Akkumulatoren; ferner Drehstrombezug. Gehört um 1913 zur "Sächsischen Elektriziäts-Lieferungsgesellschaft" |
| Quellenangaben | [Dettmar: Statistik der Elektrizitätswerke (1913) 290] [Siegel: Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft (1922) 30+148] |
| Hinweise | [Siegel: Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft (1922) 30]: Maschinenanlagen + Versorgungsgebiet, [148]: Rückkühlanlage und Kohlenagerplatz + Anbau der Schaltanlage + Bedienungsschalttafel |
| Zeit |
Ereignis |
| 02.10.1898 |
Inbetriebnahme |
| 16.02.1913 |
Beginn der Stromlieferung an die neu eröffnete Straßenbahn Hohenstein-Ernstthal – Oelsnitz |
| 1964 |
Ende der Stromerzeugung |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Elektrizität |
1898 |
Beginn |
1964 |
Ende |
|
| ZEIT | 1922 |
| THEMA | Beschreibung |
| TEXT | Die Geschichte des Elektricitätswerkes an der Lungwitz geht zurück auf einen Vertrag, den die Gemeinde Oberlungwitz, ein in der Nähe von Chemnitz gelegener Ort mit lebhafter Strumpf- und Trikotagenfabrikation, im Jahre 1897 mit der noch heute dort ansässigen Diamantfärberei Kunath & Mecklenburg über Herstellung und Betrieb eines Elektricitätswerks in Oberlungwitz abschloß. In diesen Vertrag trat alsbald die E. L. G. ein und begann mit dem Bau der Werksanlagen, die bereits Ende 1898, zunächst in bescheidenem Umfange, in Betrieb gesetzt wurden. In den vorausgehenden Blättern ist wiederholt darauf hingewiesen worden, wie sich dieses Unternehmen allmählich aus bescheidenen Anfängen zu einem umfangreichen Überlandwerk entwickelt hat und wie seine Verwaltung jederzeit bemüht war, die Stromerzeugung und -Verteilung jeweils den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen anzupassen, was, bei dem raschen Fortschreiten der Technik und der häufig wechselnden Wirtschaftslage der ansässigen Wirkindustrie dauernd frischen Wagemut und große Geldmittel erforderte. Auch ist weiter dort ausgeführt, welchen Aufschwung gerade die Wirkindustrie durch die Verwendung des elektrischen Stromes nahm, indem ihr dadurch die bequeme Möglichkeit gegeben war, mit geringem Kapital und ungehindert durch sonstige mit der Errichtung einer eigenen Krafterzeugungsstelle. verknüpfte Hemmnisse ihre Betriebsanlagen auszugestalten. Die Zahl der Gewerbebetriebe und die Steuerkraft des Gebietes haben sich denn auch seit Errichtung des Elektricitätswerkes an der Lungwitz beträchtlich erhöht.— Später als die industriell entwickelten Orte haben die landwirtschaftlichen Gemeinden von der Möglichkeit des Anschlusses, dann aber auch in umfassendem Maße, Gebrauch gemacht. Neben zahlreichen unversorgten Gemeinden wurden dem Elektricitätswerk an der Lungwitz einige bestehende Elektricitätswerke angegliedert, so im Jahre 1907 die Elektricitätswerke Burkhardtsdorf und Jahnsdorf, 1911 das Elektricitätswerk Gelenau, 1920 das Gemeinde-Elektricitätswerk Dittersdorf, das die Orte Dittersdorf, Gornau und Weißbach versorgt. Ein bemerkenswerter Beitrag für die Wandlungen kommunaler Elektrizitätspolitik bietet die im Gebiete des Elektricitätswerkes an der Lungwitz gelegene Stadt Limbach i. Sa.; die Stadt wurde früher teilweise ohne Abschluß eines besonderen Vertrages von Oberlungwitz aus versorgt, ließ sich aber später nicht abhalten, ein eigenes Elektricitätswerk zu errichten. Unter dem Zwange der Verhältnisse hat sie sich nunmehr wiederum entschlossen, dieses Werk stillzusetzen und die von den Einwohnern benötigte elektrische Arbeit von dem Elektricitätswerk an der Lungwitz zu beziehen. Von dem Kraftwerk in Oberlungwitz aus wird auch die elektrische Bahn Hohenstein—Olsnitz mit Strom versorgt.
Seit 1911 ist das Kraftwerk in Oberlungwitz durch eine 30 000-Volt-Leitung mit dem Kraftwerk Schwarzenberg verbunden.
Die Verteilung der elektrischen Arbeit erfolgte früher mit einer Spannung von 3000 Volt. Die Vergrößerung des Versorgungsgebietes machte die Erhöhung auf 6000 V und damit den teilweisen Umbau der bestehenden Leitungen erforderlich. Später ergab sich die Notwendigkeit einer nochmaligen Erhöhung auf 10.000 Volt, welche Spannung heute im wesentlichen zur Fortleitung benutzt wird. Die Zuführung des Stromes zu den Haupttransformatorenstationen erfolgt durch eine Spannung von 30 000 Volt.
Im Kraftwerk stehen folgende Betriebsmittel zur Verfügung:
7 Wasserrohr- bzw. Hochleistungskessel von rd. 2400 qm Heizfläche,
5 Drehstrom-Turbodynamos von 8000 kW,
2 Bahnumformer von 320 kW. |
| QUELLE | [Siegel: Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft (1922) 148] |
|