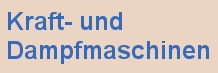| Zeit |
Ereignis |
| 03.05.1865 |
GrĂŒndung des "UHLANDSCHEN Technicums" als private technische Lehranstalt mit 11 "Zöglingen" durch Wilhelm Heinrich Uhland in Mittweida |
| 23.04.1867 bis 24.04.1867 |
Ăbersiedlung Uhlands nach Frankenberg/Sa. am 23./24. April, wo er ein weiteres Technikum eröffnet |
| 02.05.1867 |
Konstituierung des Vereins zur "Förderung des hiesigen Technicums" in Mittweida |
| 05.05.1867 |
Eröffnung des neuen "Technicums" in Frankenberg |
| 07.05.1867 |
GrĂŒndung des Technikums Mittweida als private technische Lehranstalt durch Ingenieur Carl Georg Weitzel aus Mannheim. Es werden Maschinenbau-Ingenieure ausgebildet |
| 08.05.1867 |
Erste Lehrveranstaltung im Theaterhaus zu Mittweida |
| 15.10.1867 |
Beginn des Wintersemesters mit 62 SchĂŒlern |
| 23.12.1867 |
C. G. Weitzel erwirbt die sĂ€chsische StaatsbĂŒrgerschaft |
| 01.1868 |
Das erste, nachweisbar von Weitzel erarbeitete Lehrprogramm liegt im Januar vor |
| 02.1868 |
GrĂŒndung der ersten Mittweidaer studentischen Vereinigung "Polytechnischer Verein Polyhymne" im Februar |
| 20.09.1872 |
BeschluĂ des Stadtrates von Mittweida zum Bau eines neuen GebĂ€udes fĂŒr das Technikum |
| 15.10.1873 |
Ăbergabe der ersten Etage |
| 15.10.1873 bis 31.03.1874 |
ErgĂ€nzung der Schulgesetze fĂŒr das Wirken von Vereinen am Technikum im Wintersemester |
| 30.11.1873 |
Fertigstellung des gesamten GebÀudes |
| 20.11.1874 |
Der "Verein zur Förderung des hiesigen Technicums" löst sich auf |
| 1877 |
Einrichtung eines Lesezimmers |
| 14.08.1877 |
Erster Besuch des sÀchsischen Königs am Technikum |
| Anfang 1878 |
GrĂŒndung des Techniker-Stipendienfonds Anfang 1878 |
| 30.08.1878 |
Zweiter Besuch des sÀchsischen Königs am Technikum |
| 30.11.1880 |
Franz Elsner schreibt von Schönwalde (OS) and das Technikum Mittweida und bittet um Aufnahme in die Meisterschule (fĂŒr Maschinenbau). |
| 22.04.1881 |
Franz Elsner trifft aufgrund militĂ€rischer Verpflichtungen, einschlieĂlich einer Offiziersernennung, mit zweitĂ€giger VerspĂ€tung am Technikum Mittweida ein. |
| 02.09.1881 |
Franz Elsner schreibt dem Rektor des Technikums Mittweida, Carl Georg Weitzel, und bittet um eine ErmĂ€Ăigung der StudiengebĂŒhren sowie einen Transfer zur Maschinenbauschule. Sein Vater hatte im Juli aufgrund schlechter GeschĂ€ftsbezdingungen sein GeschĂ€ft aufgegeben. |
| 15.10.1882 |
Als eine der ersten technischen Bildungseinrichtungen bietet das Technikum praktische LaborĂŒbungen im Ausbildungsprogramm an |
| 1883 |
GrĂŒndung des Mittweidaer PrĂ€siden-Convents (M.P.C.) |
| 15.10.1883 |
Franz Elsner schlieĂt sein Maschinenbaustudium am Technikum Mittweida als Drittbester in einer Klasse mit acht Studenten ab. Er findet seine erste feste Anstellung bei "Hofmann & Zinkeisen" in Zwickau und wird auf Anfrage vom Unternehmen an das Technikum von Dr. Weitzel als "sehr angenehmer, bescheidener und kompetenter junger Mann ... der sich schnell zu Ihrer Zufriedenheit hersausstellen wird" empfohlen. |
| 15.04.1884 |
Das Unterrichtsfach Elektrotechnik wird in den Lehrplan aufgenommen |
| 1885 |
Anbau des "WestflĂŒgels" am HauptgebĂ€ude |
| 15.10.1887 bis 31.03.1888 |
Ein neuer Lehrplan tritt im Wintersemester in Kraft |
| 1888 |
WeiterfĂŒhrung des "WestflĂŒgels" und Bau eines QuerflĂŒgels (des sog. "HofflĂŒgels') |
| 02.1888 |
Im Februar Bewerbung von A. U. Holzt als Lehrer fĂŒr Mathematik und Maschinenbau am Technikum Mittweida |
| 18.02.1888 |
Kontrakt von Holzt mit Weitzel als "Lehrer fĂŒr Mathematik, Mechanik, Maschinenbau" am Technikum Mittweida |
| 01.04.1888 |
Beginn der LehrtÀtigkeit von Holzt am Technikum Mittweida |
| 22.04.1889 |
Verleihung des Ordens "Ritter des Albrechtordens 1. Klasse" an C. G. Weizel |
| 20.12.1889 |
Herausgabe eines Regulativs fĂŒr das Wirken von Vereinen am Technikum |
| 1890 |
Aufstockung des VordergebÀudes um ein Stockwerk |
| 1890 |
GrĂŒndung einer mechanischen Werkstatt |
| Sommersemester 1890 |
Die elektrotechnische Ausbildung wird im Sommersemester ausgedehnt |
| 16.07.1890 |
Dritter Besuch des sÀchsischen Königs |
| 16.06.1891 |
Auflösung des Kontraktes von Holzt mit Weitzel |
| 01.07.1891 |
Holzt erwirbt das Technikum Mittweida und beschÀftigt 25 Lehrer und 9 Beamte |
| 20.03.1892 |
Festakt zur 25-Jahrfeier des Technikums Mittweida im SchĂŒtzenhaus, Ernennung Weitzels zum Königlichen Kammerrat. Er scheidet als Direktor aus |
| 31.03.1892 |
Bis zum 31.3.1892 ĂŒbernimmt Holzt gemeinsam mit Weitzel die Leitung des Technikums |
| 01.04.1892 |
VollstĂ€ndige Ăbernahme der Leitung des Technikums durch Alfred Holzt |
| 19.12.1892 |
Holzt verbietet 11 Studentenverbindungen von etwa 20 bestehenden am Technikum Mittweida mit "landsmÀnnischem" Charakter; Vereine mit wissenschaftlichen oder sportlichen Zielen bestehen weiter. Protest von etwa 200 Studenten vor dem Technikum |
| 11.01.1893 |
Bauantrag fĂŒr ein GebĂ€ude des Technikums, speziell fĂŒr den elektrotechnischen Unterricht, beim Stadtrat Mittweida |
| 01.04.1893 |
Holzt fĂŒhrt gedruckte AnstellungsvertrĂ€ge ein und erlĂ€Ăt das "Dienstreglement" fĂŒr Lehrer des Technikums Mittweida |
| 06.02.1894 |
Einweihung und erster Unterricht im "Electrotechnischen Institut" des Technikums Mittweida; Holzt investiert 200.000 Mark fĂŒr die technische Ausstattung und die Sammlungen aus seinem Privatvermögen |
| 03.1895 |
Erste Vergabe von Stipendien aus dem Techniker-Stipendienfonds im MĂ€rz. Holzt spendet 3.000 Mark fĂŒr den Fonds |
| 1897 |
Auszeichnung des Technikums Mittweida mit der Königlich-SĂ€chsischen Staatsmedaille fĂŒr gewerbliche Verdienste" - insbesondere fĂŒr die hervorragenden Leistungen im technischen Unterrichtswesen |
| 01.10.1897 |
Gehaltserhöhung fĂŒr alle LehrkrĂ€fte des Technikums Mittweida durch EinfĂŒhrung einer Gehaltsskala; die zusĂ€tzliche finanzielle Belastung fĂŒr Holzt betrĂ€gt vorerst 40.000 Mark im Jahr |
| 22.01.1898 bis 23.01.1898 |
Streitereien von Studenten mit der Polizei, bekanntgeworden als "Schlacht bei Sanitas", da sie vom Cafe Sanitas ausgehen. |
| 15.10.1898 bis 31.03.1899 |
Im Wintersemester 1898/99: Trennung der Ausbildung in "Maschinenbau" und "Elektrotechnik" |
| 22.11.1899 |
Holzt teilt dem Stadtrat von Mittweida den geplanten Bau eines "Maschinenbau-Laboratoriums mit LehrwerkstÀtten" mit |
| 22.11.1899 |
Holzt unterrichtet den Stadtrat vom geplanten Bau eines Maschinenbau-Laboratoriums am Technikum Mittweida. |
| 1900 |
Rasmussen studiert um 1900 an der Ingenieurschule Mittweida |
| 1900 |
Bau des "ZwischenflĂŒgels" am HauptgebĂ€ude und Errichtung des glasĂŒberdachten "Lichthofes" des Technikums |
| 21.02.1900 |
Holzt sendet an den geehrten Stadtrat zu Mittweida ein Gesuch mit beiliegenden Zeichnungen "... zum Neubau des Maschinenbau-Laboratoriums mit dem ergebenen Ersuchen, die baupolizeiliche PrĂŒfung und Genehmigung recht bald herbeifĂŒhren zu wollen." |
| 23.04.1900 |
Holzt erhĂ€lt den Bauerlaubnis-Schein fĂŒr den Neubau eines Maschinenbau-Laboratoriums mit LehrwerkstĂ€tten. |
| 01.05.1900 |
Holzt willigt in den Kauf- und Ăberlassungsvertrag vom 30. MĂ€rz 1900 ein und ist auch bereit, die AnhegerbeitrĂ€ge zu zahlen. |
| 04.06.1900 |
Holzt beantragt erste AbÀnderungen und ErgÀnzungen zu seinem Antrag zum Maschinenbaulaboratorium vom 22.11.1899. |
| 1901 |
Holzt hebt das Vereinsverbot am Technikum Mittweida von 1892 auf |
| 28.03.1901 |
Holzt beantragt beim Stadtrat Mittweida die im neuen Maschinenbau-Laboratorium installierte elektrische Licht- und Kraftanlage mit der im Elektrotechnischen Institut bereits vorhandenen in Verbindung bringen zu dĂŒrfen. Die Genehmigung wird am 1.5.1901 erteilt. |
| 30.03.1901 |
Inbetriebnahme der Lehr-FabrikwerkstÀtten und des Maschinenbaulaboratoriums. In dieser Einrichtung findet sowohl die Ausbildung als auch die Herstellung von Erzeugnissen des Maschinenbaus und der Elektrotechnik statt |
| 30.03.1901 |
Das Bau-Revisions-Protokoll vom 30.3.1901 bestĂ€tigt die ordnungsgemĂ€Ăe BauausfĂŒhrung des "Neubaues eines Maschinenbau-Laboratoriums und LehrlingswerkstĂ€tten". Der Stadtrat erlaubt die offizielle Inbetriebnahme zum 12. April 1901. |
| 09.05.1901 |
Holzt ĂŒberreicht dem Stadtrat zu Mittweida 2 Exemplare der Arbeitsordnung, welche vom 23. Mai d. J. an in den WerkstĂ€tten des Maschinenbau-Labotatoriums eingefĂŒhrt wird. |
| 27.12.1901 |
Holzt beantragt einen Erweiterungsbau der LehrwerkstĂ€tten fĂŒr die "PrĂ€zise". (7 Shed) |
| 1902 |
Das Technikum beschÀftigt 60 Lehrer und Beamte |
| 20.01.1902 |
Holzt erhĂ€lt den Bauerlaubnis-Schein fĂŒr die beabsichtigte Erweiterung des Maschinenbau-Laboratoriums. |
| 24.02.1902 |
Holzt beantragt einen weiteren Anbau an das Maschinenbau-Laboratorium. (8 Shed) |
| 11.03.1902 |
Holzt erhĂ€lt den Bauerlaubnis-Schein fĂŒr die beabsichtigte verĂ€nderte AusfĂŒhrung des unter dem 20. Januar d. J. genehmigten Anbaues. |
| 04.04.1902 |
Ernennung Holzts zum Professor |
| 22.04.1902 |
Verleihung des Professorentitels an A. Holzt |
| 03.05.1902 |
Holzt gibt den Abschluss der Bauarbeiten fĂŒr das Maschinenbaulaboratorium bekannt. |
| 1903 |
Das Technikum Mittweida prÀsentiert sich mit seinen LehrfabrikwerkstÀtten auf der deutschen StÀdteausstellung in Dresden. |
| 1904 |
Herausgabe mehrsprachiger Sonderdrucke zu den Aufnahmebedingungen in den "PrÀzisions- und Lehr-FabrikwerkstÀtten des Technikums". |
| 12.02.1904 |
GrĂŒndung der PrĂ€zisionswerkstĂ€tten Mittweida GmbH; diese Bezeichnung gilt jetzt fĂŒr die Lehr-FabrikwerkstĂ€tten |
| 01.04.1905 bis 30.09.1905 |
EinfĂŒhrung der Automobiltechnik im Sommersemester als Lehrfach |
| 09.05.1905 |
EnthĂŒllung einer Gedenktafel zum 100. Todestag Friedrich Schillers, die Tafel stifteten alle studentischen Verbindungen und Landsmannschaften |
| 12.04.1907 |
Besuch des Königs Friedrich August von Sachsen am Technikum Mittweida mit Besichtigung des "Electrotechnischen Instituts" und der PrĂ€zisionswerkstĂ€tten sowie anschlieĂendem FrĂŒhstĂŒck in der Villa des Direktors Holzt |
| 12.04.1907 |
Besuch des SÀchsischen Königs Friedrich August III. in Mittweida. Er besichtigt auch das "Elektrotechnische Institut" und die "PrÀzise". |
| 04.10.1908 |
Holzt lehnt im Namen der Direktion zum wiederholten Male die Studienaufnahme weiblicher Personen am Technikum Mittweida ab; die ersten MÀdchen studieren erst ab November 1944 an der Mittweidaer IngenieurausbildungsstÀtte |
| 1909 |
ProzeĂ gegen russische Studenten des Technikums in Dresden |
| 18.03.1909 |
GrĂŒndung der "Alt-Herren-VerbĂ€nde Deutscher Corporationen zu Mittweida e.V." (V.A.H.D.C.M.e.V.) |
| 15.10.1909 bis 31.03.1910 |
Im Wintersemester 1909/10: Aufnahme der Flugtechnik in den Lehrplan |
| 10.02.1911 |
Auflösung des Verbandes der Vereine "Badenia", "Bavaria", "Fidelitas", "Plattonia", "Rheno-Guestphalia" und "Saxonia" |
| 27.11.1911 |
Regulativ der Landesregierung zur Arbeit der Technika |
| 30.04.1913 |
GrĂŒndung des Mittweidaer Landsmannschaften Cartell (M.L.C.) |
| 01.08.1914 |
Holzt unterrichtet Studenten "feindlicher Staaten" kurzzeitig weiter |
| 10.1914 |
Holzt bietet den stÀdtischen Kollegien an, die aufgetretenen LehrerausfÀlle an den stÀdtischen Schulen durch Personal des Technikums auszugleichen |
| 01.04.1915 |
FĂŒr das Sommersemester 1915 wird ein ausfĂŒhrliches Programm der Lehr- und FabrikwerkstĂ€tten Mittweida herausgegeben. |
| 13.09.1915 |
Die Direktion gibt bekannt, daĂ 214 ehemalige Studenten verwundet und 68 im Weltkrieg gefallen seien |
| 25.10.1916 |
Holzt richtet ein UnterstĂŒtzungsgesuch an den Stadtrat von Mittweida wegen drohender SchlieĂung des Technikums; die Stadtverordneten lehnen ab |
| 07.05.1917 |
AnlĂ€Ălich der 50-Jahrfeier des Technikums wird Prof. Holzt der Titel eines königlich-sĂ€chsischen Hofrates durch den Kreishauptmann in einer bescheidenen Feierstunde verliehen |
| 10.1917 |
Mit Beginn des Wintersemesters wird ein erweitertes Studienprogramm angeboten. Es werden die neuesten Erkenntnisse der Elektro- und Nach richtentechnik, Automobil- und Flugtechnik und des Maschinenbaus gelehrt |
| 1919 |
Anbau am Maschinenbaulaboratorium |
| 01.10.1919 |
Holzt ĂŒbertrĂ€gt Paul Kamprath das Ressort "Vereine am Technikum" |
| 03.10.1919 |
Holzt kauft das GrundstĂŒck des "Vereins fĂŒr die Herberge zur Heimat" Tzschirnerplatz/WeitzelstraĂe la und richtet dort die Bibliothek und eine mechanische Werkstatt ein. |
| 10.06.1920 |
GrĂŒndung des Mittweidaer Senioren Convents (M.S.C.) |
| 01.07.1920 |
Einrichtung einer "Speiseanstalt fĂŒr Studierende" |
| 04.1921 |
Installation einer elektrischen Beleuchtung am Technikum, anstelle der bisherigen Gasbeleuchtung |
| 1922-1923 |
In der Zeit der Inflation verzeichnet das Technikum mit 2142 Studenten die höchsten Besucherzahlen, 50% hiervon waren AuslÀnder |
| 1923 |
Holzt unterstĂŒtzt den Bau einer StudentenkĂŒche am Technikum; die Direktion spendet dafĂŒr 10.000,- Mark |
| 13.03.1923 |
Holzt stellt beim Reichsministerium des Innern den Antrag um Aufnahme des Technikums Mittweida in die "Reichsliste der anerkannten höheren technischen Lehranstalten" |
| 04.04.1923 |
Eröffnung einer SuppenkĂŒche fĂŒr Studenten |
| 18.02.1925 bis 19.02.1925 |
Der GutachterausschuĂ fĂŒr das technische Schulwesen lehnt die Aufnahme des Technikums Mittweida in die "Reichsliste der anerkannten höheren technischen Lehranstalten" ab |
| 15.10.1925 |
Eröffnung der Mensa academica in einem eigenen GebÀude |
| 26.05.1926 |
Nutzungsbeginn der Modellhalle, in der die Sammlungen des Technikums Mittweida untergebracht sind |
| 05.07.1926 |
Gesuch an den Reichsminister des Innern um RĂŒcknahme des ablehnenden Beschlusses des Gutachterausschusses (bezgl. staatliche Anerkennung) |
| 1927 |
Anbau an die Modellhalle zur Unterbringung der Sammlung fĂŒr Flugtechnik |
| 02.06.1927 bis 03.06.1927 |
Das sechzigjĂ€hrige JubilĂ€um wird in feierlicher Form begangen. Die Alfred-Holzt-Stiftung wird beim Technikum Mittweida ins Leben gerufen. EnthĂŒllung eines Denkmals fĂŒr die Gefallenen des Ersten Weltkrieges |
| 1928 |
Laboratorien fĂŒr Kraftfahrzeug- und Flugtechnik sowie fĂŒr Werkzeugmaschinen und SchweiĂtechnik werden geschaffen |
| 1929 |
Das Technikum Mittweida unterhĂ€lt enge Beziehungen zu bedeutenden Industrieunternehmen Deutschlands, unter anderem zu: Bayerische Motorenwerke, MĂŒnchen; Siemens & Halske AG, Berlin; Siemens & Schuckert, NĂŒrnberg; Telefunken, Berlin; ZĂŒndapp GmbH, NĂŒrnberg; AEG, Berlin; Deutsche Werft, Hamburg; Heinkel Flugzeugwerke, Rostock |
| 01.01.1929 |
Prof. A. Holzt tritt in den Ruhestand, zeichnet aber weiterhin alle offiziellen Dokumente des Technikums |
| 16.01.1929 |
Das Technikum Mittweida wird in "Vereinigte Technische Lehranstalten des Technikums Mittweida" und spĂ€ter in "Vereinigte Technische Lehranstalten Mittweida" umbenannt. Die Ausbildung umfaĂt jetzt 6 Semester |
| 04.12.1929 bis 05.12.1929 |
Der GutachterausschuĂ fĂŒr das technische Schulwesen stimmt der Eintragung der "Vereinigten Technischen Lehranstalten des Technikums Mittweida" in die "Reichsliste der anerkannten höheren technischen Lehranstalten" zu |
| 05.12.1929 |
Der "ReichsgutachterausschuĂ fĂŒr technisches Schulwesen" nimmt die Bildungseinrichtung mit EinschrĂ€nkungen in die "Reichsliste" auf |
| 06.02.1930 |
Durch das Reichsministerium des Innern erfolgt die Aufnahme der Vereinigten technischen Lehranstalten des Technikums Mittweida" mit BeschrÀnkung in die Reichsliste |
| 1933 |
In der PrÀzise kommt die Produktion zum Erliegen |
| 01.09.1933 |
Prof Holzt ĂŒbertrĂ€gt Ingenieur Hans Gehringer die Leitung der gesamten Maschinenbaulaboratorien und der angegliederten WerkstĂ€tten, ehemals PrĂ€zisionswerkstĂ€tten. |
| 09.03.1935 |
Die Mittweidaer Lehranstalt erhÀlt den Namen "Ingenieurschule Mittweida" |
| 18.10.1935 |
Auflösung der deutschen Korporationen und Gleichschaltung im "NSD-Studentenbund" (gegr. im Januar 1926) |
| 29.05.1936 |
Der "Verein der Förderer der Ingenieurschule Mittweida" konstituiert sich |
| 15.06.1936 |
Der langjĂ€hrige Direktor Prof. Alfred Holzt gibt die Leitung der Ingenieurschule endgĂŒltig ab. Der Erste Lehrer, Julius Anselm, ĂŒbernimmt das Direktorenamt |
| 01.07.1937 |
Wegfall bisheriger BeschrĂ€nkungen und FĂŒhrung als Höhere Technische Lehranstalt in der "Reichsliste" |
| 26.02.1938 |
GrĂŒndung des "Internationalen Mittweida Ingenieurvereins" in Kopenhagen |
| 09.05.1938 |
Die Stadt Mittweida und der "Verein der Förderer der Ingenieurschule Mittweida« errichten die Stiftung "Ingenieurschule Mittweida (Höhere Technische Lehranstalt)". |
| 09.05.1938 |
Konstituierung der Stiftung "Ingenieurschule Mittweida (Höhere Technische Lehranstalt)" |
| 01.09.1938 |
Die Stiftung der Ingenieurschule Mittweida erwirbt alle Einrichtungen vom bisherigen Besitzer, Prof A. Holzt |
| 01.09.1938 |
Ăbernahme der privaten Bildungseinrichtung, einschlieĂlich "PrĂ€zise" durch die Stiftung "Ingenieurschule Mittweida (Höhere Technische Lehranstalt)". |
| 25.10.1938 |
Prof Dr. habil. Ludwig Zipperer von der Technischen Hochschule Karlsruhe wird Direktor. J. Anselm tritt in den Ruhestand |
| 01.12.1938 |
Dr. Oster teilt dem Amtsgericht Mittweida mit, "... dass nach Ăbergang der GebĂ€ude und des Inventars der PrĂ€zisionswerkstĂ€tten Mittweida GmbH auf die Stiftung »Ingenieurschule Mittweida (Höhere Technische Lehranstalt)« kein Vermögen mehr vorhanden ist, und dass deshalb die Löschung nunmehr erfolgen kann." |
| 05.12.1938 |
Auflösung der PrÀzisionswerkstÀtten als selbstÀndige Firma |
| 1940 |
Antrag der Direktion auf Erweiterung des Lehrangebotes |
| 08.05.1942 |
Feier zum 75-jÀhrigen Bestehen der Mittweidaer IngenieurausbildungsstÀtte |
| 1943 |
91 BeschÀftigte der "PrÀzise" arbeiten in den WerkstÀtten der Ingenieurschule. |
| 31.01.1945 |
Einstellung des Lehrbetriebes an der Ingenieurschule |
| 14.04.1945 |
Direktor Zipperer verlĂ€Ăt die Einrichtung und ĂŒbertrĂ€gt Paul Beckers die Leitung |
| 14.04.1945 |
Einzug amerikanischer Truppen in Mittweida |
| 15.05.1945 |
Besetzung Mittweidas durch sowjetische Truppen |
| 13.08.1945 |
Der Stiftungsvorstand beauftragt Hugo Schulz mit der FĂŒhrung der DirektionsgeschĂ€fte |
| 05.09.1945 |
Tod von Alfred Udo Holzt in Mittweida |
| 01.10.1945 |
Feierstunde zur Wiedereröffnung aller Schulen in Mittweida |
| 31.10.1945 |
Hans von Beeren wird als Direktor eingesetzt |
| 10.12.1945 |
J. Anselm wird stellvertretender Direktor |
| 15.01.1946 |
Die Ingenieurschule Mittweida stellt den Lehrbetrieb auf Anordnung der SMAD ein. |
| 02.1946 |
Beginn der Demontagen in der Ingenieurschule im Februar |
| 28.06.1946 |
Das Mitglied des Stiftungsvorstandes, BĂŒrgermeister Dr. Huth, nimmt eine Trennung der RĂ€umlichkeiten des GrundstĂŒcks »Am Schwanenteich 6« vor. Sowohl die Ingenieurschule als auch die WerkstĂ€tten erhalten RĂ€ume. |
| 01.08.1946 |
Ingenieurschule und WerkstĂ€tten werden buchhalterisch getrennt. Somit arbeitet die »PrĂ€zise« als selbstĂ€ndiger Betrieb der Stiftung und ist nur dem Stiftungsvorstand rechenschaftspflichtig. Die »PrĂ€zise« muss sich jedoch gegenĂŒber der Schule verpflichten, eine Reihe von Praktikanten gegen VergĂŒtung zu beschĂ€ftigen. |
| 03.1947 |
Der Stiftungsvorstand "Ingenieurschule Mittweida (Höhere Technische Lehranstalt" beschlieĂt mit Genehmigung des Ministeriums fĂŒr Volksbildung im MĂ€rz die Auflösung der Stiftung zum 31.3.1947. |
| 21.03.1947 |
Auflösung des Vereins der Förderer der Ingenieurschule Mittweida |
| 31.03.1947 |
Auflösung der Stiftung |
| 01.04.1947 |
Ăbernahme der PrĂ€zisionswerkstĂ€tten in stĂ€dtisches Eigentum |
| 16.04.1947 |
Die Kommune Mittweida ĂŒbernimmt das Vermögen der Stiftung "Ingenieurschule Mittweida" |
| 08.1947 |
Hermann Trenkmann ĂŒbernimmt die DirektionsgeschĂ€fte |
| 01.10.1947 |
J. Anselm wird Direktor |
| 01.11.1947 |
Wiedereröffnung der Ingenieurschule und Ausbildung in den Fachrichtungen Maschinenbau, Landmaschinen- und Kraftfahrzeugbau |
| 13.05.1948 |
Die Satzung der Studierendenschaft der Ingenieurschule Mittweida tritt in Kraft |
| 21.06.1949 |
GrĂŒndung der Hochschulsportgemeinschaft |
| 02.08.1949 |
Unterstellung der Ingenieurschule unter die Hauptverwaltung Wirtschaftsplanung, Abteilung Fachschulen, des Landes Sachsen |
| 01.09.1949 |
H. Tauscher von den Technischen Lehranstalten Chemnitz wird als Direktor eingesetzt |
| 01.11.1949 |
Ăbernahme der Direktion durch H. Bremser |
| 01.06.1950 |
Zuordnung der Ingenieurschule zum Ministerium fĂŒr Industrie der DDR |
| 12.10.1950 |
Die Ingenieurschule erhÀlt den Namen "Fritz Selbmann" |
| 01.01.1951 |
M. Schneidereit wird Direktor |
| 1951-1954 |
Umwandlung zur Fachschule fĂŒr Elektrotechnik (1951-54). Die Ausbildung erfolgt in den Fachrichtungen: FernmeldegerĂ€tebau, Licht- und Röhrentechnik, Elektromedizinische GerĂ€te und Röntgenapparate, Technologie der Elektrotechnik, ElektrowĂ€rme |
| 03.1951 |
Der "EuropÀische Hof" wird im MÀrz Studentenwohnheim |
| 01.09.1953 |
Eröffnung einer neuen Mensa in der ehemaligen Modellhalle |
| 16.10.1953 |
Einweihung des neuen LaborgebÀudes |
| 01.01.1954 |
Ăbernahme von GebĂ€udeteilen der ehemaligen PrĂ€zise und Einrichtung von WerkstĂ€tten durch die Ingenieurschule |
| 29.11.1955 |
Ehrung Bernhard Schmidts zu dessen 20. Todestag |
| 26.02.1956 |
Die Einrichtung fĂŒhrt den Namen "Ingenieurschule Mittweida, Fachschule fĂŒr Elektrotechnik" |
| 01.09.1957 |
Ăbergabe des ersten Wohnheimneubaus, danach bis 1961 drei weitere. GesamtkapazitĂ€t etwa 600 PlĂ€tze |
| 01.04.1958 |
GrĂŒndung des Kammerorchesters |
| 09.1958 |
Durch VerĂ€nderung der Ausbildungsstruktur entstehen im September die neuen Fachrichtungen: GerĂ€te der Nachrichtentechnik, Anlagen der Nachrichtentechnik, Elektrische Regelungstechnik, StrahlenmeĂtechnik, Feinwerktechnik/Konstruktion und Feinwerktechnik/Technologie. |
| 06.04.1960 bis 07.04.1960 |
"Elektrokonferenz" am 06./07. April in Berlin |
| 09.1961 |
Eine weitere Profilierung fĂŒhrt zu den Fachrichtungen: Informationstechnik, Fernmeldetechnik/Hochfrequenztechnik, Steuer- und Regelungstechnik, Elektrofeinwerktechnik/Konstruktion und Elektrofeinwerktechnik/Technologie |
| 02.05.1967 bis 07.05.1967 |
Festwoche zum 100-jÀhrigen JubilÀum der Ingenieurschule Mittweida |
| 01.09.1968 |
Die ersten drei Seminargruppen des Ingenieurhochschulstudiums werden immatrikuliert |
| 01.09.1969 |
Die Ingenieurschule erhĂ€lt den Status einer Ingenieurhochschule GrĂŒndungsrektor Prof, Dr. rer. oec. habil. Reinhard Göttner ĂŒbernimmt sein Amt. Die Sektion "Elektronischer GerĂ€tebau" wird gegrĂŒndet |
| 12.09.1969 |
Festakt zur Investitur des Rektors und GrĂŒndung der Ingenieurhochschule Mittweida mit der Sektion "Elektronischer GerĂ€tebau" |
| 01.07.1970 |
GrĂŒndung der Sektionen 1nformationselektronik" und "Mathematik, Kybernetik und Informationsverarbeitung" |
| 01.11.1971 |
Inbetriebnahme des Organisations- und Rechenzentrums |
| 02.10.1972 |
Verleihung des Diplomrechts (Diplomingenieur) |
| 25.07.1973 |
Ăbergabe eines Wohnheimes mit 442 PlĂ€tzen |
| 01.09.1973 |
FĂŒr alle Fachrichtungen der Ingenieurhochschulen tritt ein verbindlicher Lehrplan in Kraft |
| 14.03.1974 |
Eröffnung des Studentenclubs |
| 01.09.1975 |
Beginn der Vorkursausbildung |
| 01.09.1976 |
Die Ausbildung umfaĂt acht Semester und schlieĂt mit der Verleihung des akademischen Grades "Diplomingenieur" ab |
| 05.09.1976 |
Das Komplexpraktikum "Elektroniktechnologie" wird eingeweiht |
| 01.04.1978 |
Die Zahl der Sektionen wird auf zwei verringert, die als Sektionen "Technologie des Elektronischen GerÀtebaus" und "Informationselektronik" bezeichnet werden |
| 01.02.1980 |
Verleihung des Promotionsrechtes zum "Doktor Ingenieur" |
| 01.09.1981 |
RektoratsĂŒbernahme durch den Physiker Prof Dr. sc. nat. Gerhard ZSCHERPE |
| 01.01.1983 |
GrĂŒndung des Zentrums Elektronischer GerĂ€tebau (ZEG) |
| 01.07.1983 |
Beginn der Fertigung elektronischer Baugruppen und GerĂ€te fĂŒr den Lehr- und Forschungsbedarf des Hochschulwesens der DDR |
| 20.12.1983 |
Einweihung des Komplexes Hochschulbibliothek/Mensa |
| 30.08.1984 bis 31.08.1984 |
1. Konferenz "wissenschaftlicher GerÀtebau im Hochschulwesen der DDR" (276 Teilnehmer). |
| 27.11.1985 |
Bernhard-Schmidt-Kolloquium zu dessen 50. Todestag |
| 20.05.1988 |
Inbetriebnahme des Laserapplikationszentrums "Lasertechnik und -technologie" |
| 15.10.1988 bis 31.03.1989 |
Die Ausbildung erfolgt im Wintersemester in den Fachrichtungen: Mikroelektronik, GerĂ€tetechnik, Informationstechnik Das Studium umfaĂt neun Semester |
| 13.12.1989 |
AuĂerordentliche Sitzung des Wissenschaftlichen Rates |
| 07.09.1990 |
Investitur des von den Mitarbeitern demokratisch gewÀhlten Rektors Prof. DrAng. habil. Reinhard SCHMIDT |
| 31.05.1991 |
Einweihung eines neuen LaborgebÀudes |
| 06.10.1991 |
Beginn des Fachhochschulstudiums in zehn StudiengÀngen |
| 16.03.1994 |
Beschluss des Senates zum Aufbau des Studienganges "Medientechnik". |
| 19.07.1994 |
Ablehnung des eingereichten Studienganges "Medientechnik" durch das SĂ€chsische Staatsministerium fĂŒr Wissenschaft und Kunst mit der Empfehlung eine Vertiefungsrichtung "Medientechnik" einem geeigneten Studiengang zuzuordnen. |
| 10.1994 |
Im Oktober Immatrikulation der ersten Studenten im Studiengang "Elektrotechnik", Studienrichtung "Medientechnik", dem spÀteren Studiengang "Medientechnik". |
| 08.10.1997 |
Start des ersten deutschen Hochschulfernsehens durch den SÀchsischen MinisterprÀsidenten Prof. Dr. Kurt Biedenkopf |