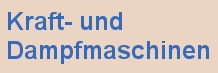|
|
G. Pschorr, PschorrbrÀu
| Firmenname | G. Pschorr, PschorrbrÀu |
| Ortssitz | MĂŒnchen |
| Ortsteil | 15 |
| StraĂe | Bayerstr. 32 |
| Postleitzahl | 80335 |
| Art des Unternehmens | Brauerei |
| Anmerkungen | Auch: "G. Pschorr, Brauerei zum Pschorr" (1885). [MAN] gibt die Neuhauser Str. an. Um 1943 unter der Firma "PschorrbrÀu A.-G.". Seit 1972 "Hacker-Pschorr BrÀu AG" (s.d.) |
| Quellenangaben | [Reichs-AdreĂbuch (1900) 396] [Hoppenstedt; Brauereien und MĂ€lzereien (1982) D 177] [MAN-Dampfmaschinenliste (1896)] [Handbuch Akt.-Ges. (1943) 247] |
| Zeit |
Ereignis |
| 1422 |
Entstehung der BraustÀtte |
| 1820 |
GrĂŒndung von Josef Pschorr (1770-1841) durch Ăbernahme der seit 1422 bestehenden BraustĂ€tte. - Weitere Besitzer: der 1798-1867 lebende Sohn Georg des GrĂŒnders, danach dessen von 1830-1894 lebender Sohn Georg und anschlieĂend dessen Söhne August, Georg Theodor und Josef bis 1922 |
| 14.09.1922 |
Umwandlung des Unternehmens in eine A.-G. |
| 27.09.1922 |
Eintragung der AG |
| 1928 |
Die Gesellschaft beteiligt sich an der SchloĂbrauerei Planegg bei MĂŒnchen A.-G. und ĂŒbernimmt durch AbschluĂ eines Pachtvertrages deren Betrieb. |
| 1929 |
Ăbernahme des Anwesenbesitzes der offenen Handelsgesellschaft G. Pschorr in MĂŒnchen und Berlin |
| 29.12.1933 |
Durch BeschluĂ der Hauptversammlung vom 29. Dezember 1933 ist die SchloĂbrauerei Planegg aufgelöst worden und in Liquidation getreten. Der Liquidator wird ermĂ€chtigt, das Vermögen im Ganzen auf die PschorrbrĂ€u A.-G., MĂŒnchen, zu ĂŒbertragen. |
| 1934-1935 |
Verkauf eines nicht benötigten GelÀndes in Planegg |
| 22.09.1934 |
Die Firma der SchloĂbrauerei Planegg bei MĂŒnchen A.-G. wird gelöscht. |
| 1938 |
Verkauf des Restareals in Planegg |
| 24.02.1943 |
Letzte ordentliche Hauptversammlung bis 1943/44 |
| 1972 |
Fusion zu "Hacker-Pschorr BrÀu AG" |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Bier |
1885 |
[MAN-Dampfmaschinenliste] |
1904 |
[MAN-Dampfmaschinenliste] |
|
| ZEIT | 1943 |
| THEMA | Organe und Kapital der Gesellschaft |
| TEXT | Vorstand: Dir. Hans PfĂŒlf, MĂŒnchen; Dir. Dipl.-Ingenieur Walter Pschorr, MĂŒnchen; Dir. Dipl.-Kfm. Max Drummer, MĂŒnchen, stellvertretend; Dir. Fritz Köhler, MĂŒnchen, stellvertretend. Prokuristen: Architekt Richard Röhrl, Direktor; Reisedir. Joh. Hartmann; Ober-Ingenieur Friedrich Leyh. Braumeister: Friedrich Halder. Aufsichtsrat: Generaldir. Franz Josef Popp, MĂŒnchen, Vorsitzer; Geh. Kommerzienrat Georg Th. Pschcrr, MĂŒnchen, stellv. Vorsitzer; Generaldir. Friedrich Döhlemann, MĂŒnchen; Geheimer Kommerzienrat Franz Kustermann, Tutzing; Herbert Pschorr, MĂŒnchen; Geheimer Kommerzienrat Robert Röchling, Davos-Platz; Justizrat Dr. Christoph Schramm, MĂŒnchen; Horst Freiherr von Uckermann, Berlm-Wilmersdorf; Rechtsanwalt Dr. Franz Woeber, MĂŒnchen. Stimmrecht: Je nom. RM 1.000,00 Aktie 1 Stimme. Gewinn-Verwendung: GemÀà Aktiengesetz. GeschĂ€ftsjahr: 1. September bis 31. August. Grundkapital: nom. RM 5.000.000,00 Stammaktien in 5000 StĂŒcken zu je RM 1.000,00. GroĂaktionĂ€r: Familie Pschorr (100%). |
| QUELLE | [Handbuch Akt.-Ges. (1943) 247] |
| |
| ZEIT | 1943 |
| THEMA | Zweck und Gegenstand des Unternehmens |
| TEXT | Produktion: UntergĂ€rige Biere, Malz fĂŒr eigenen Bedarf, Eis, Nebenprodukte. Zweck: Betrieb des Braugewerbes und aller dazu gehörigen und damit im Zusammenhang stehenden Nebengewerbe. |
| QUELLE | [Handbuch Akt.-Ges. (1943) 247] |
| |
| ZEIT | 1943 |
| THEMA | BesitzverhÀltnisse |
| TEXT | Grundbesitz: Gesamt 195980 qm (gröĂtenteils bebaut), davon Brauerei 22830 qm (gröĂtenteils bebaut). Anlagen: 1. HauptmĂ€lzerei, dem eigentlichen Brauereibetrieb an der BayerstraĂe angegliedert, fĂŒr eine Jahresverarbeitung bis 100000 Ztr. Gerste; Gerstenputzerei (ca. 50 Ztr. stĂŒndliche Leistung), 3 Gerste-Vorrats-Silos; Weichhaus mit 6 Weichen aus Eisenbeton mit je 400 Ztr. Fassungsvermögen; Keimkastenanlage mit 9 KeimkĂ€sten (fĂŒr je 350 Ztr. Gerste ausreichend); 4 Doppeldarren mit je rund 65 qm HordenflĂ€che; Malzschrotanlage mit 2 SchrotmĂŒhlen (stĂŒndliche Leistung von 40 Ztr. je MĂŒhle), 4 SchrotrĂŒmpfe zur Aufbewahrung des Malzes. 2. MĂ€lzerei, in der alten BraustĂ€tte an der Neuhauser StraĂe (Betrieb zur Zeit stillgelegt), mit einer Jahresproduktion von ca. 20000 Ztr. Malz; Weichanlage und 2 Doppeldarren mit je 65 qm HordenflĂ€che. Betriebsanlagen: Sudhaus mit 2 Sudwerken, GĂ€rkeller mit rund 13 000 hl GĂ€rraum (70 GĂ€rgefĂ€Ăe von 20 bis ĂŒber 200 hl Fassungsvermögen); Lagerkeller, zweistöckig, mit 36 Abteilungen und einem Fassungsraum fĂŒr 62 000 hl Bier mit FĂ€ssern in der GröĂe von 20 bis 700 hl Inhalt aus Holz, emaillierte bzw. rostfreie Stahltanks, Aluminium- und Eisenbetontanks; AbfĂŒllanlagen fĂŒr das Stadt- bzw. VersandgeschĂ€ft und fĂŒr die Flaschenbier-Abteilung1; Flaschenbier-Abteilung (l Aggegrat mit 5000, 1 mit 7000 Flaschen Stundenleistung); Schwankhalle mit 2 FaĂreinigungsmaschinen (Leistung bis zu 300 FĂ€ssern in der Stunde); Kesselhaus mit 3 SchrĂ€gwasserrohrkesseln; Maschinenhaus: Maffei-Verbund-Dampfmaschine fĂŒr den Betrieb der KĂ€ltemaschinen und der umfangreichen elektrischen Anlage und Pumpen, mehrere Kolben- und einen Wasserringkompressor fĂŒr den PreĂluftbedarf; KĂŒhlanlage mit 3 Linde-Kompressoren (zusammen 2 Mill. WE KĂ€lteleistung pro Stunde), mit denen im Nebenbetrieb tĂ€glich bis zu 1900 Ztr. Eis erzeugt werden können; elektrische Anlage: 4 Dynamomaschinen und etwa 300 Elektromotoren fĂŒr Licht- und Kraftzwecke. |
| QUELLE | [Handbuch Akt.-Ges. (1943) 247] |
|