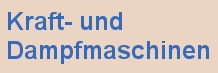|
|
Steinkohlenbauverein Kaisergrube zur Gersdorf
| Firmenname | Steinkohlenbauverein Kaisergrube zur Gersdorf |
| Ortssitz | Gersdorf (├╝. Hohenstein-Ernstthal) |
| Art des Unternehmens | Kohlebergwerk |
| Anmerkungen | 110 ha gro├čes Grubenfeld; grenzt im Osten an den "Lugauer Steinkohlenbauverein", im Westen an den "Gersdorfer Steinkohlenbauverein" und im S├╝den an den "Steinkohlenbauverein Concordia" an. Um 1885 mit je einer F├Ârdermaschine auf Schacht I und Schacht II; beide wurden in diesem Jahr auf Ehrhardt-und-Sehmer'sche Steuerung umgebaut, verbunden mit einer gro├čen Kohlenersparnis. 1908 zusammen mit "Steinkohlenbauverein Concordia" (s.d.) fusioniert zu "Gewerkschaft Kaisergrube" (s.d.). |
| Quellenangaben | [Vogel: Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier (1991) 110+114] [Jahrbuch f├╝r das Berg- und H├╝ttenwesen (1887) II,124] |
| Zeit |
Ereignis |
| 1871 |
Gr├╝ndung zum Abbau der Kohlefelder links der Stra├če Lugau - Gersdorf. |
| 09.1871 |
Mit dem Abteufen der Kaisergrube Schacht I wird begonnen. Die Arbeit geht schnell voran. |
| 21.02.1872 |
Teufbeginn f├╝r Schacht Kaisergrube II. Die Arbeit geht wegen Geldmangels schleppend voran. |
| 1874 |
Der Schacht Kaisergrube I erreicht bei einer Teufe von 585 m das erste Fl├Âz mit 3,90 m M├Ąchtigkeit. - Es folgen weitere abbauw├╝rdige Fl├Âze. |
| 1875 |
Die Teuf-Arbeiten f├╝r Schacht Kaisergrube I werden in 620 m Teufe zun├Ąchst beendet |
| 1875 |
Beginn der F├Ârderung |
| 1879 |
Der Schacht Kaisergrube I wird von 620 m auf 636 m Teufe weitergeteuft. |
| 1879 |
Schacht Kaisergrube II erreicht eine vorl├Ąufge Teufe von 636 m |
| 1882 |
Zur Verarbeitung der Klarkohle wird eine Kokerei gebaut. - Nach anf├Ąnglichen Schwierigkeiten wird brauchbarer Koks erzeugt. |
| 1885 |
Die Kokerei wird wegen zu geringen Nutzens wieder eingestellt. |
| um 1900 |
Die Grube hat gute wirtschaftliche Ergebnisse. |
| 1902/03 |
Schacht Kaisergrube II erreicht die End-Teufe von 689 m (einschl. Sumpf) |
| 1908 |
Gr├Â├če und F├Ârdermenge sind zu klein und unwirtschaftlich. Daher erfolgt der Zusammenschlu├č mit dem "Steinkohlenbauverein Concordia" zur "Gewerkschaft Kaisergrube". |
| 1920 |
Bis zur Vereinigung der "Gewerkschaft Kaisergrube" zur "Gewerkschaft Gottes Segen" wurden 6,5 Millionen Tonnen Kohle gef├Ârdert |
| 1930 |
Stillegung der beiden Sch├Ąchte durch die "Gewerkschaft Gottes Segen" |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Steinkohle |
1875 |
Beginn der F├Ârderung |
1908 |
Fusion zu "Gewerkschaft Kaisergrube" |
|
| Bezeichnung |
Bauzeit |
Hersteller |
| Dampfkompressor |
1884 |
Zwickauer Maschinenfabrik AG |
| Zeit |
Objekt |
Anz. |
Betriebsteil |
Hersteller |
Kennwert |
Wert |
[...] |
Beschreibung |
Verwendung |
| 1898 |
Dampfkessel |
4 |
Schacht II |
unbekannt |
Heizfl├Ąche je |
150 |
qm |
Batteriekessel |
|
| ab 1899 |
Dampfkessel |
1 |
Schacht I |
unbekannt |
Heizfl├Ąche |
143 |
qm |
Batteriekessel |
|
| ab 1903 |
Dampfkessel |
1 |
Schacht I |
unbekannt |
Heizfl├Ąche |
150 |
qm |
Doppel-Cornwallkessel mit 10 at ├ťberdruck |
|
Zeit = 1: Zeitpunkt unbekannt
| Zeit |
Bezug |
Abfolge |
andere Firma |
Kommentar |
| 1909 |
Zusammenschlu├č, neuer Name |
danach |
Gewerkschaft Kaisergrube |
[Vogel: Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier (1991) 19] |
| ZEIT | 1884 |
| THEMA | Beschreibung |
| TEXT | Im 1. (Gl├╝ckauf-) Fl├Âtz wurde der ├╝ber der 600-Metersohle in S├╝d und vom Bremsberge 17 in West vorgerichtete Feldteil
von dem Hauptverwerfen herein in Angriff genommen und der Abbau der Pfeiler vom Bremsberge 4 in Ost und West fortgesetzt, bis die Entwicklung von Brandgasen die Absperrung dieses Feldtheiles n├Âtig machte. Weitere Abbaue gingen in diesem Fl├Âtz ├Âstlich ├╝ber der 600-Metersohle vom Bremsberg 4 in S├╝d und unterhalb dieser Sohle von Grundstrecke 3 in Nord um, w├Ąhrend im Westfl├╝gel die Baue im Mittelfeld beendet wurden. Im Vertrauenfl├Âtz, in welchem im Ostfl├╝gel der Abbau der vorgerichteten Pfeiler fortgesetzt wurde, konnten auch im Westfl├╝gel einige in fr├╝heren Jahren abgesperrte Fl├Âtzpartieen n├Ârdlich und s├╝dlich vom Bremsberg 13 c abgebaut werden. Westlich vom Bremsberg 3 werden beide Fl├Âtze gemeinschaftlich abgebaut, da das sonst zwischen l und 12 m m├Ąchtige Zwischenmittel
hier fast verschwunden ist. Im 3. (Haupt-) Fl├Âtz kam im Ostfl├╝gel ein Teil des s├╝dlich vom Bremsberg 9 vorgerichteten Feldes zum Verhieb, doch mu├čte im Westfl├╝gel der im Vorjahre abgesperrte Feldteil der Sicherheit wegen noch abgeschlossen bleiben; dagegen wurde im Fallen unterhalb der Strecke 13 c ein gr├Â├čerer, ziemlich regelm├Ą├čig abgelagerter Feldteil vorgerichtet. Der tiefe Querschlag der 621-Metersohle erreichte im Mai 1884 bei
180 m Entfernung vom Schachte I in S├╝d das, von unten nach oben aus l,2 m reiner Ru├čkohle, 0,4 m kremsiger Kohle und 0,4 m Ru├čkohle mit Pechstreifen bestehende 4. (Grund-) Fl├Âtz. Der obere Querschlag der 536-Metersohle des Schachtes I wurde im Ganzen 375 m in S├╝d zu Felde gebracht; beim Betriebe desselben mu├čte man von der von vornherein angenommenen Streichrichtung abgehen, da die in den darunter lagernden Fl├Âtzen gemachten Aufschl├╝sse ergaben, da├č das Hauptverwerfen sich in eine Anzahl von kleinen Verwerfungen zersplittert hat und man bei Beibehaltung der urspr├╝nglichen Lehre Gefahr gelaufen w├Ąre, ├╝ber die Pl├Âtze hinwegzufahren. Die Beendigung dieses Querschlages und der Durchschlag desselben mit den betreffenden Bauen wird f├╝r die gesammte Wetterwirtschaft der Grube von gro├čem
Vorteil sein, da die Wetter alsdann nahezu in den h├Âchsten Punkten abgef├╝hrt werden k├Ânnen. Im Juli 1884 wurde der neue, doppelzylindrige Kompressor in Gang gesetzt. |
| QUELLE | [Jahrbuch f├╝r das Berg- und H├╝ttenwesen (1886) 130] |
|