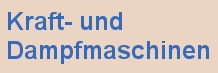|
|
Steinkohlenzeche Vereinigte SĂ€lzer und Neuack
| Firmenname | Steinkohlenzeche Vereinigte SĂ€lzer und Neuack |
| Ortssitz | Essen (Ruhr) |
| Ortsteil | Altendorf |
| Postleitzahl | 45143 |
| Art des Unternehmens | Kohlebergwerk |
| Anmerkungen | In Altendorf/Frohnhausen. Konsolidiert 1804. Ab 1806: Tiefbau auf dem Josina-Schacht; Josina war ein kombinierter Pump- und Förderschacht. 1852/55: Krupp-Zeche. 1913: 2 FörderschĂ€chte. Um 1822 auch Schacht Waldthausen. 1925: Briefanschrift: Kruppsche Verwaltung der Zeche ver. SĂ€lzer-Neuack, Essen; Direktor: Bergassessor Dr. Max Wemmer; fördernde SchĂ€chte u. Teufe: Doppelschacht Huyssen 520 m; StĂŒckgut: Essen-Nord, Filiale Krupp-GĂŒterschuppen, Wagenladungen: Essen Hbf; Filiale Krupp-Westen; Kohlenart: Fettkohle. Beteiligung s. Krupp; Bergrevier: Werden. Nicht in [Wegweiser Kohlenreviere NRW (1955)]. |
| Quellenangaben | [Jb dt Braunkohlen-...-Ind (1913) 127] [Reichs-AdreĂbuch (1900) 2244] [GHH-Lieferverzeichnis] [Akten Oberbergamt Dortmund; Staatsarchiv MĂŒnster] [Bergwerke und Salinen (1925) 117] |
| Zeit |
Ereignis |
| 1806 |
Dinnendahl erhĂ€lt den Auftrag fĂŒr eine 40zöllige Wasserhaltungsmaschine fĂŒr die Zeche SĂ€lzer und Neuack. Es wird ihm der Bau der Wasserhaltungsmaschine und der 15zölligen Fördermaschine (aus einem Kessel gespeist) ĂŒbertragen. |
| 1806 |
Starker Wasserandrang auf Schacht "Josina", so daà die Pferdekunst nicht ausreicht. Daher erhÀlt Dinnendahl den Auftrag zum Bau einer Wasserhaltungsmaschine (Jahr zweifelhaft, da lt. [Huske (1999), S. 840] Teufbeginn erst 1807) |
| 1807 |
Ăbergang zum Tiefbau auf Schacht "Josina" |
| 03.1809 |
Inbetriebnahme der Dinnendahl-Wasserhaltungsmaschine auf Schacht "Josina" nach groĂen Schwierigkeiten der GHH beim GuĂ des Dampfzylinders: Er muĂte wegen Nicht-MaĂhaltigkeit fĂŒnfmal gegossen werden. Da die GHH keine so groĂen Schmelzöfen hat muĂ er in drei Teilen gegossen werden. Inbetriebnahme im MĂ€rz oder am 13. Januar 1809. |
| 1811 |
Inbetriebnahme der Dinnendahl-Fördermaschine auf Schacht "Josina" von "SÀlzer und Neuack" - die erste Dampffördermaschine des Ruhrgebiets (lt. [Huske (1999) S. 840] schon im Juni 1809 als kombinierte Wasserhaltungs- und Fördermaschine) |
| 1820 |
Johann Dinnendahl (MĂŒlheim (Ruhr) ĂŒbernimmt den GuĂ einer Wasserpumpe fĂŒr die Zeche. |
| 1822 |
Aufstellung einer Wasserhaltungsmaschine von Harkort in Wetter |
| 12.03.1824 |
Auftrag einer Dampffördermaschine an die GHH |
| 20.11.1824 |
Abnahme der von der GHH gebauten Dampffördermaschine auf Schacht Waldthausen (lt. [Huske (1999) S. 840] wird 1825 die auf Schacht "Josina" nicht mehr gebrauchte Wasserhaltungs-/Fördermaschine ĂŒbernommen) |
| 21.04.1910 |
Baubeginn (?) einer Dampfmaschine durch Kuhn/Maschinenfabrik Esslingen. |
| Produkt |
ab |
Bem. |
bis |
Bem. |
Kommentar |
| Heizgas |
1922 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
1925 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
|
| Koks |
1913 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
1925 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
|
| Leuchtgas |
1913 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
1925 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
|
| schwefelsaures Ammoniak |
1913 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
1925 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
|
| Steinkohle |
1852 |
GHH-Fördermaschine |
1925 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
|
| Teer |
1913 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
1925 |
[Bergwerke u. Salinen (1925) 117] |
|
| Zeit |
gesamt |
Arbeiter |
Angest. |
Lehrl. |
Kommentar |
| 1913 |
1969 |
1896 |
73 |
|
davon 1690 Vollarbeiter bzw. 55 technische und 18 kaufmÀnnische Beamte |
| 1922 |
2551 |
2414 |
137 |
|
davon 2215 Vollarbeiter bzw. 88 technische und 49 kaufmÀnnische Beamte |
| 1923 |
2452 |
2312 |
140 |
|
davon 2139 Vollarbeiter bzw. 96 technische und 44 kaufmÀnnische Beamte |
| 1924 |
2152 |
2021 |
131 |
|
davon 1660 Vollarbeiter bzw. 92 technische und 39 kaufmÀnnische Beamte |
| 1925 |
2136 |
2021 |
115 |
|
davon 1770 Vollarbeiter bzw. 81 technische und 34 kaufmÀnnische Beamte |
| von |
bis |
Produkt |
im Jahr |
am Tag |
Einheit |
| 1913 |
1913 |
Steinkohle |
586770 |
|
t |
| 1913 |
1913 |
Koks |
165273 |
|
t |
| 1913 |
1913 |
schwefelsaures Ammoniak |
2015 |
|
t |
| 1913 |
1913 |
Stickstoffinhalt |
419 |
|
t |
| 1913 |
1913 |
Teer |
4212 |
|
t |
| 1913 |
1913 |
Leuchtgas |
9053000 |
|
cbm |
| 1922 |
1922 |
Steinkohle |
434829 |
|
t |
| 1922 |
1922 |
Koks |
121285 |
|
t |
| 1922 |
1922 |
schwefelsaures Ammoniak |
1359 |
|
t |
| 1922 |
1922 |
Stickstoffinhalt |
282 |
|
t |
| 1922 |
1922 |
Teer |
2310 |
|
t |
| 1922 |
1922 |
Leuchtgas |
18173000 |
|
cbm |
| 1922 |
1922 |
Heizgas |
6292000 |
|
cbm |
| 1923 |
1923 |
Steinkohle |
342558 |
|
t |
| 1923 |
1923 |
Koks |
93337 |
|
t |
| 1923 |
1923 |
schwefelsaures Ammoniak |
1024 |
|
t |
| 1923 |
1923 |
Stickstoffinhalt |
212 |
|
t |
| 1923 |
1923 |
Teer |
1849 |
|
t |
| 1923 |
1923 |
Leuchtgas |
12079000 |
|
cbm |
| 1923 |
1923 |
Heizgas |
3015000 |
|
cbm |
| 1924 |
1924 |
Steinkohle |
420699 |
|
t |
| 1924 |
1924 |
Koks |
78086 |
|
t |
| 1924 |
1924 |
schwefelsaures Ammoniak |
905 |
|
t |
| 1924 |
1924 |
Stickstoffinhalt |
788 |
|
t |
| 1924 |
1924 |
Teer |
1418 |
|
t |
| 1924 |
1924 |
Leuchtgas |
7721000 |
|
cbm |
| 1924 |
1924 |
Heizgas |
803000 |
|
cbm |
| 1925 |
1925 |
Steinkohle |
492749 |
|
t |
| 1925 |
1925 |
Koks |
119838 |
|
t |
| 1925 |
1925 |
schwefelsaures Ammoniak |
1371 |
|
t |
| 1925 |
1925 |
Stickstoffinhalt |
207 |
|
t |
| 1925 |
1925 |
Teer |
2632 |
|
t |
| 1925 |
1925 |
Leuchtgas |
9044000 |
|
cbm |
| 1925 |
1925 |
Heizgas |
9116000 |
|
cbm |
| ZEIT | 1809 |
| THEMA | Dinnendahl'sche Wasserhaltungsmaschine |
| TEXT | Von dem Jahre 1803 ab setzt jedoch nunmehr die Dampfmaschine als Hilfsmittel des Bergbaues ein. Die erste auf
einem deutschen Bergwerk aufgestellte "Feuermaschine", wie sie genannt wird, wurde auf dem jetzt Krupp gehörigen Steinkohlenbergwerk "Vereinigte SĂ€lzer und Neuack" im Jahre 1803 durch Franz Dinnendahl aufgestellt. Bis dahin waren die Steinkohlenbergwerke fast alle ĂŒber der Stollensohle abgebaut und, soweit man mit Handpumpen hatte kommen können, war geunterwerkt. Der erste Tiefbauschacht auf einem Ruhrkohlenbergwerk wurde, durch die preuĂische Bergbehörde angeregt, auf den Zechen "SĂ€lzer und Neuack" angelegt, deren Gewerke sich zu diesem Zwecke konsolidierten; der Auftrag, die zu diesem Zwecke erforderliche, auf der sogenannten Röttgersbank aufzustellende 40zöllige Dampfmaschine zu bauen, wurde vom Bergamt, welchem ja nach unseren frĂŒheren AusfĂŒhrungen die Oberaufsicht ĂŒber alle auf den auch den Privaten
gehörigen Zechen vorzunehmenden VerĂ€nderungen unterstand, dem "Mechaniker" Franz Dinnendahl ĂŒbertragen. Er selbst erzĂ€hlt darĂŒber: "Auf dem Wege zu diesem Termin der Auftragerteilung fiel mir ein, daĂ es vielleicht möglich sei, mit der anzulegenden 40zölligen Dampfmaschine zur WĂ€ltigung der Wasser zugleich eine zwölf- bis 15-zöllige Fördermaschine zu verbinden, womit man nicht allein die Kohlen um 3/4 Unkosten weniger als bei den hier bekannten Förderungsvorrichtungen zu Tage bringen, sondern auch so viel fördern könne, als es der Debit
erheische, wenigstens in jeder Schicht von 8 Stunden 1000 bis 1500 Ringel. In einer halben Stunde war dieses Projekt, wenigstens in meinem Kopfe, im Reinen, ohne daà ich eine solche Fördermaschine jemals gesehen hÀtte.
Mein Vorschlag wurde geprĂŒft, angenommen und der Kontrakt abgeschlossen. Nach diesem Kontrakt sollte ich fĂŒr die 40zöllige Wasserhaltungsmaschine 14.000 und fĂŒr die damit zu verbindende 15zöllige Fördermaschine 2.800 Reichstaler erhalten. Ăber die Maschine selbst berichtet Dinnendahl an das Oberbergamt: Diese Maschine wurde im Jahre 1809 fertig, obgleich ich sie schon im Jahre 1806 akkordiert hatte. Die Ursache davon, daĂ es so lange dauerte, ehe ich den Bau dieser Maschine beendigt hatte, war, daĂ ich den Zylinder wegen der damals im GieĂen groĂer StĂŒcke noch unvollkommenen Eisenhlitte zu Sterkrade fĂŒnf mal von neuem und dennoch in drei StĂŒcken muĂte giessen lassen, ehe derselbe brauchbar war, welches mir nicht nur groĂen Schaden, sondern auch mancherlei VerdrieĂlichkeiten verursachte. Die Maschine ist nach neuem Prinzip erbaut, und der Zylinder der Wasserhaltungsmaschine hat 40 und der der Fördermaschine 15 Zoll rheinlĂ€ndisch im Durchmesser. Die LĂ€nge
des Balanziers an der ersteren ist 24 FuĂ, die Dicke 26 und 30 Zoll; die LĂ€nge des Balanziers an letzterer ist 16 FuĂ und die Dicke 13 und 15 Zoll. Die Dimension der ĂŒbrigen Teile der Wasserhaltungsmaschine ist
folgende: Der Kessel, der fĂŒr beide Maschinen die DĂ€mpfe liefert, ist 9 FuĂ breit und 14 FuĂ lang und hat also eine QuadratflĂ€che von 126 FuĂ. Der Rost ist 472 FuĂ breit und 7 FuĂ lang, also 31,5 QuadratfuĂ. Die Dampfröhre hat 10 Zoll, die Dampf-, Kommunikations- und Kondensor-Ventile 10 Zoll, der Kondensor 13 Zoll, das Einspritzungsventil 2,5 Zoll, die Kanalröhre 9 Zoll, das Kanalventil 8 Zoll, die Luftpumpe 16 Zoll, die Auslassungsröhren an derselben 7 Zoll, die Nahrungspumpe 9 Zoll und die Warmwasserpumpe 3,5 Zoll. Die
Schachtteufe bis an die Stollensohle betrĂ€gt 22 Lachter Die Schachtpumpe besteht aus zwei SĂ€tzen und der Durchmesser derselben ist 15 Zoll. Die Hubhöhe ist 6 FuĂ und die Maschine kann pro Minute 5 bis 18, höchstens 20 mal heben. Da nun auch hier, wie auf der Zeche Wohlgemuth, der Bau mit 22 Lachter Teufe unter der Stollensohle und das Gebirge ĂŒber derselben auch unbedeutend ist, also nur in der oberen Höhe getrieben wird,
und daher die zu wĂ€ltigenden Wasser aus den nĂ€mlichen Ursachen wie dort verschieden sind, so lĂ€Ăt sich auch hier die pro 24 Stunden gewĂ€ltigt werdende QuantitĂ€t Wasser nicht ganz bestimmt angeben. Man kann indes mit GewiĂheit sagen, dass die Maschine bei trockener Witterung jetzt 7 bis 9 und bei nasser 12 bis 15 mal pro Minute heben muss. Da nun jeder Hub ca. 7,33 KubikfuĂ Wasser bringt, so werden bei trockener Witterung 44 bis 58,66 und bei nasser ca. 88 bis 110 KubikfuĂ Wasser pro Minute gewĂ€ltigt. Bei dieser Gelegenheit halte
ich es, da mir die Aufsicht ĂŒber die Maschine ĂŒbertragen ist, fĂŒr meine Pflicht zu bemerken, dass bei der im verflossenen Winter anhaltend gewesenen nassen Witterung die Maschine bei den vielen WasserzugĂ€ngen die Wasser kaum hat bewĂ€ltigen können, obgleich sie per Minute 15 bis 18 mal gehoben hat. Der Kohlenverbrauch bei dieser Maschine ist fĂŒr jede 24 Stunden ebenfalls nicht genau anzugeben. Man braucht, je nachdem die Witterung die WasserzugĂ€nge vermehrt oder vermindert, tĂ€glich am wenigsten 36 bis 40 und am meisten 50 bis
60 Ringel Kohlen, so dass man im Durchschnitt tĂ€glich ca. 45 Ringel rechnen kann. Die Kohlen sind ĂŒbrigens fette und von vorzĂŒglicher QualitĂ€t. Nur das ist schlimm, daĂ sie mit etwas Schiefer vermischt sind. Hierbei ist aber zu bemerken, daĂ diese Kohlen nicht bloĂ zur WasserwĂ€ltigung erforderlich sind, sondern daĂ dabei auch noch tĂ€glich 1000 bis 1200 Ringel Kohlen gefördert werden.
Bei der Wasserhaltungsmaschine sind in 24 Stunden zwei WĂ€rter und zwei SchĂŒrer und bei der Fördermaschine pro Schicht nur ein WĂ€rter nötig, wovon jeder WĂ€rter pro Schicht 36 und die SchĂŒrer 30 StĂŒber an Schichtlohn erhalten. Die Unterhaltungskosten, nĂ€mlich an Schmiede- und Gusseisenteile, Arbeitslöhne und zur Feuerung nötige Kohlen inklusive der MaschinenwĂ€rterlöhne werden monatlich ca. 500 bis 550 Taler klevisch betragen.
Wahrscheinlich wird es der höheren und höchsten Behörde auffallend sein, daĂ diese Maschine monatlich soviel an Unterhaltungskosten bedarf. Die Hauptursache davon ist, dass frĂŒher, als das wohllöbliche Bergamt die Aufsicht darĂŒber fĂŒhrte, oft Leute zu MaschinenwĂ€rtern angestellt wurden, welche die Sache nicht gehörig kannten und auch von der Behörde nicht dazu instruiert werden konnten, wodurch dann nicht selten kostspielige Reparaturen veranlaĂt wurden. Auch die Unvollkommenheit der GuĂeisenteile war zum Teil Ursache dieser öfteren kostspieligen Reparaturen, weil man auf der EisenhĂŒtte zu Sterkrade, da dieses die erste Maschine war, zu denen diese Teile dort gegossen wurden, die Maschinenteile noch nicht wie jetzt mit der nötigen Vollkommenheit zu verfertigen wuĂte. Da ich nun die Angabe der Unterhaltungskosten im Durchschnitt von mehreren Jahren angegeben habe, in welchen auch diese Reparaturkosten mit hineingerechnet sind, so kann diese Angabe nicht im VerhĂ€ltnis mit den Unterhaltungskosten einer Maschine von dieser GröĂe stehen, wobei Leute als WĂ€rter angestellt sind, die die Sache kennen. KĂŒnftighin werden von der Zeit an, daĂ ich die Aufsicht darĂŒber fĂŒhre, diese Unterhaltungskosten monatlich nicht viel ĂŒber 300 bis 350 Taler kommen." |
| QUELLE | [Neubaur: Mathias Stinnes und sein Haus (1909) 208] |
|